28. Dezember 2014
Was vom Jahr bleibt 2014
Marie-Luise Angerer
Variationen von Nicht-Hören – in Theater, Film und Fernsehen
Gerade noch eine Karte für TAUBERBACH von Alain Patel, dem belgischen Regisseur und Choreografen, bekommen, der im Frühjahr 2014 zum Theatertreffen nach Berlin ins HAU eingeladen wurde. Immer begeisterter betrachte ich das fantastische Bühnenbild mit seinem Leben: Kleiderberge und Stoffhaufen, aus denen sich langsam Menschenglieder schälen und in unglaublichen Verrenkungen aller ihnen zur Verfügung stehenden Muskeln ihre jeweilige Geschichte tanzen. Ausgangspunkt für TAUBERBACH ist die Dokumentation Estamira von Marcos Prado über eine schizophrene Frau in Brasilien, die versucht auf einer Müllhalde zu überleben, ohne ihre Würde dabei zu verlieren. Doch der Titel Tauber Bach verdankt sich noch einer anderen Inspirationsquelle, nämlich einem Projekt von Artur Zmijewski mit Musik von Bach, gesungen von Gehörlosen.
In HER von Spike Jonze – ebenfalls in diesem Frühjahr gesehen und mehrfach darüber gearbeitet – wird gehört, geredet und wieder gehört. Die Stimme des Operating Systems (OS) bzw. Scarlett Johanssons Stimme als unsichtbares Interface, die der Imagination nicht nur keine Schranken, sondern das in Bewegung setzt, was Lacan immer schon gesagt hatte – wenn Du nämlich in der Liebe einen Blick verlangst, dieser immer schon ein Verfehltes ist und man nie dort gesehen wird, wo man den anderen sieht, und umgekehrt man das, was man sieht, nie erblicken wollte. Was sich in HER aber offenbart, ist mehr als nur die Delegation der Gefühlsartikulation an eine Maschine, vielmehr zeigt sich im Erfolg der Stimme des OS, dass der Ursprung der Selbstbezüglichkeit weniger auf die Abwesenheit eines Signifikanten verweist (wie bei Derrida zur Stimme nachzulesen ist), stattdessen den ihr eigenen Algorithmus ausstellt. HER führt vor Augen, wie die Maschine als zunächst Fremde zum zutiefst Eigenen immer schon geworden ist – zum Mehr-als-ich-Selbst. Und dies nicht, weil das OS so raffiniert ist, sondern Subjekt und Stimme nie zur Deckung gelangen und sich gegenseitig dort berühren, wo das eine nicht ist und die andere nicht hört.
Die erste Staffel von MASTERS OF SEX lief 2013, die zweite in diesem Jahr. In der 6. Episode von 2013 (2014 erst angeschaut!) ist Anna Freud zu einem Vortrag an die University of Washington St. Louis eingeladen, wo William Masters und Virginia Johnson gerade mit ihren Forschungen zum weiblichen Orgasmus begonnen haben. Auf die Frage von Virginia, ob denn Sigmund Freud sich niemals Gedanken darüber gemacht habe, seine Behauptungen zur weiblichen Sexualität empirisch zu untermauern, meint Anna Freud, sie verstehe die Frage nicht. Ihr Vater habe seinen Kollegen stattdessen den Rat erteilt, sich vielmehr an die Dichter zu wenden, um dort über das Rätsel der Weiblichkeit etwas zu hören – zwischenzeitlich hat sich aber herumgesprochen, dass die Ärzte dort auch nichts oder anderes gehört haben …
Sven Beckstette
Meshell Ndegeocello, 31. Oktober 2014, Bix Jazzclub, Stuttgart
Von den vielen herausragenden Platten dieses Jahres (Neneh Cherry, Shabazz Palaces, Flying Lotus, D'Angelo to name but a few) hat mich Comet, Come To Me von Meshell Ndegeocello vielleicht am meisten beeindruckt. Konzentriert und trotzdem fließend, vertrackt und dennoch eingängig, brachial und dabei immer auch zerbrechlich: Die zwölf Stücke der Platte zeigen Ndgeocello auf der Höhe ihrer Kunst. Im Konzert im Stuttgarter Jazzclub Bix braucht es anfangs ein bißchen, bis das Quartett sich gefunden hat. Die Bandleaderin selbst gibt sich scheu bis distanziert. Nach einer guten halben Stunden allerdings bricht das Eis und es wird deutlich, dass an diesem Abend Musik ensteht, die sich mit den herkömmlichen Kategorien nicht beschreiben lässt. Schlicht großartig!
Christian Petzold, Phoenix
Nach den eher zurückhaltenden bis unschlüssigen Kritiken zu Christan Petzolds Phoenix war ich skeptisch, ob sich der Holocaust tatsächlich mit den Mitteln von Melodram und Film Noir darstellen lässt, wie es der Regiesseur versucht. Meine Zweifel verflogen im Delphi Kino jedoch rasch, weil Petzold die Motive seiner Figuren klar hervortreten lässt, ohne ihnen die Vielschichtigkeit zu nehmen und zudem noch Raum für Gefühle einräumt: Nelly, die das Vernichtungslager überlebt hat, möchte, dass es so wird wie vor der NS-Zeit. Ihr Mann, der sie nicht erkennt, rettet sich in den Glauben, dass sie Tod ist, ja Tod sein muss, um sich nicht mit seinem Verrat auseinandersetzen zu müssen und obendrein noch von ihrem Erbe profitieren zu können. Die Freunde wollen erst gar nicht wissen, wie es im KZ war und beklagen lieber ihre eigenen Verluste. Bei der Schlussszene stockt einem der Atem: Wie Nelly da buchstäblich ihre Stimme (wieder)findet und erkennt, dass ein Zurück nicht möglich ist, während die Personen ihres Umfeldes sich ihrer Schuld bewusst werden, hier wird aus einem Opfer ein Mensch und aus Menschen Täter, hier zeigt sich eindringlich, dass es ein richtiges Leben im falschen nicht gibt. In meinen Augen Petzolds bislang bester Film.
Diedrich Diederichsen, Über Pop-Musik
Das Material habe er nun wirklich genügend beschrieben, so rechtfertigte Diedrich Diederichsen seinen Ansatz, das Phänomen Pop-Musik theoretisch zu durchdringen. Tatsächlich gibt sein Buch nicht die Geschichte des Pop und seiner Stile wieder, sondern versucht, dessen Wesen zu erfassen. Zugegeben: Nicht alle Kapitel sind gleichermaßen überzeugend. Wenn Diederichsen jedoch eine Argumentationslinie gelingt – und das ist meistens der Fall, entsteht eine Sicht auf Pop-Musik, die zu völlig neuen Hörerlebnissen führt. Vor allem die Abschnitte über die Stimme und das Jazz-Subjekt stechen hervor und sind so noch nie formuliert worden. Und auch das zeichnet das Buch aus: Nach der Lektüre hat man das drindgende Bedürfnis, über das gerade Gelesene zu diskutieren. Anregend und gehaltvoll, ohne belehrend zu sein
Raymond Bellour
Pendant plus de dix ans, publiant dans la Bibliothèque de la Pléiade les Oeuvres Complètes d'Henri Michaux, j'ai dépouillé avec amour et scrupule ses moindres catalogues de peintures et dessins. Quand j'ai ouvert des années plus tard, cette année, le catalogue de l'exposition Momente de Winthertur (septembre-novembre 2013), j'ai été saisi d'un éblouissement. Je connaissais peu ces oeuvres, toutes issues de collections des pays germanophones. Mais je les reconnaissais pourtant une à une, tant tout l'art de Michaux, fait d'éclats instantanés de traits, de tons, de tâches mélangés, de visages et de corps incertains, est instantanément signé, comme Klee avant lui qu'il admirait tant.
Pourquoi le dernier film de Godard est-il son plus beau, son plus fort depuis longtemps? Parce que l'usage de la 3D favorise une individuation plus ou moins constante de l'ensemble des plans qui se heurtent sans cesse l'un à l'autre comme des cellules disjointes, déjouant toute totalisation, aussi bien représentative qu'idéologique - c'est la nouveauté radicale de ce film qui, empruntant encore des motifs à l'Histoire (en majuscule) et toujours irrigué par des semblants d'histoires (en minuscule), ne cesse de se résorber dans la discontinuité des fragments de présent absolu qui le composent. Et c'est un présent pacifié qui d'autre part s'instaure autour de la figure de Roxy, le chien, l'animal rilkéen irradié par le calme et la splendeur de la nature dont il participe.
J'entends à France-Culture, dans l"excellence émission culturelle «La Dispute», deux critiques s'enthousiasmant pour l'exposition de la collection d'art brut de Bruno Decharme montrée à Paris à la Maison Rouge : ils vantent la supériorité de ces oeuvres ouvrant sur des mondes, tous les mondes possibles, sur celles de l'art contemorain trop vouées à la simple autoréflexion de leurs propres processus. J'y cours, et c'est ce que je vois, dans une constante magnifiscence de couleurs et de traits : des mondes – des écritures, des visages, des cartes, des calculs, des prophéties, des corps, infiniment de corps, des scénographies d'une complexité de rêve, tous les états propres aux tourments psychiiques que la métamorphose d'un art tente d'apaiser, dans autant d'intenses solitudes. Aloïse Corbaz, une des grandes artistes de l'art brut, l'énonce ainsi : «Je déplore la situation d'épouse de la conflagration universelle».
Johannes Beringer
Ich habe mir die frühen Filme von Miklós Jancsó angeschaut – und dabei festgestellt, dass er in diesem Jahr (31. Januar) in Budapest gestorben ist. Auf Cantata (1963), der noch von Antonioni beeinflusst ist, folgen die Filme, deren Ästhetik Aufsehen erregt hat: die langen, schweifenden, immer elaborierteren Einstellungen in Breitleinwand konzentrieren sich obsessiv auf das Thema Krieg – auf diesen kalten Mechanismus, der einsetzt, wenn die Macht militärisch erobert oder zurückerobert worden ist. (My Way Home, 1964, The Round-Up, 1965, The Red and the White, 1967, Silence and Cry, 1968, Red Psalm, 1971.) In einem Booklet habe ich die Worte «sourde violence» aufgeschnappt – Charakter der dumpfen oder tauben Gewalt, die in immergleichen Abläufen besteht, Logik der militärischen und zivilen Machtsicherung. Eine Ausnahme bildet The Confrontation, von dem man 1968 oder danach einiges hätte lernen können.
Dass unsere Kalte Kriegs-Kanzlerin etwas zu den Folterberichten aus USA sagen würde, war nicht zu erwarten. (Auch sonst schwieg man sich eher aus.) Was da in der Presse und den Medien (auch bei einer Fraktion der Grünen) grassierte, war ja schon länger vorgegeben: Russenhass und blinde Amerikaverehrung. (Altes Feindbild, wiederbelebt.)
Auf der zweitletzten Seite von Stefan Ripplingers Einige Ansichten unter freiem Himmel. Joseph Joubert (1754-1823) heisst es: «Un meilleur langage a de meilleures opinions. Eine bessere Sprache hat bessere Ansichten. – Und alle meine Sterne in einem Himmel. – Der ganze Weltraum ist meine Leinwand. Sterne des Geistes regnet es auf mich herab. – Et toutes mes étoiles dans le ciel. – Tout l’espace est ma toile. Il me tombe des étoiles de l’esprit.»
(Die Republik, Nummer 110, 15. Oktober 2001. Hrsg. von Petra und Uwe Nettelbeck.)
Ein Stück Himmel für Harun Farocki ... (Viennale / James Benning, Farocki, USA 2014, 77 Minuten).
Johannes Binotto
Immer noch und immer wieder dran an Sam Wassons wuchtiger Biographie FOSSE (Houghton Mifflin Harcourt Publishers), die Glanz und Elend des grossen Choreographen und Musical-Neuerfinders als jenen Countdown erzählt, als die Bob Fosse seine selbstzerstörerische Karriere immer praktiziert hat. Von «Sixty Years» bis «One Hour and Fifty-Three Minutes» wird runtergezählt – so die Kapitelüberschriften. Raketenstarts und Todestriebe funktionieren so. Das eigene vor- und zurückspringende und nie zum Schluss kommende Lesen aber schlägt derartiger Ausweglosigkeit ein Schnippchen, so wie ich am Ende von Fosses All That Jazz auch jeweils immer noch mal den Anfang schauen muss. It‘s Showtime, Folks!
Endgültig zu Ende hat Charles Burns mit Suger Skull (Pantheon Books) seine zwischen Tintin und Psychose changierende Comic-Trilogie gebracht. Ein Ende, das gerade darum so bedrückend, weil so banal ist. Das Gewöhnliche ist immer das Schrecklichste, was einem passieren kann. Dazu alles in leuchtenden Farben gezeichnet und darum so dunkel.
Das Bilderbuch Der Bär, der nicht da war (Verlag Antje Kunstmann) von Oren Lavie mit Wolf Erlbruchs Illustrationen (Übersetzung Harry Rowohlt) war plötzlich da – ein ganz unerwartetes Geschenk von Freunden. «Ich will geradeaus.» – «Ja, ich weiss wo das ist», nickte die Schildkröte, «es ist sehr beliebt. Heutzutage scheint da jeder hinzufahren.»
Marianne Faithfull singt weiter. Der sagenhafte Rauch, der auf dem Cover von «Give My Love to London» (naïve Records) aus ihrem Mund wabert, kommt von einem Nikotinverdampfer. Wer sonst kommt mit so was durch? Die Songs stammen von Roger Waters («Sparrows Will Sing») bis Nick Cave («Late Victorian Holocaust») und gehören doch ganz ihr.
Under the Skin, finaler Kameraschwenk nach oben in jenen Himmel, von dem Schnee fällt und plötzlich sieht es aus, als würden die Flocken nicht dem Objektiv entgegen segeln, sondern umgekehrt als flöge die Kamera durch weissen Sternenschauer: billigster und überzeugendster Special Effekt des ganzen Filmjahres. Leicht abgekupfert freilich bei Carl Theodor Dreyer.
Daneben viel vergangenes Kino geschaut, das sich ganz neu anfühlt: Strange Impersonation von Anthony Mann – Frauennarbengesichtseifersuchtsmelothriller mit falschem Flashback, der beruhigend wirken soll, in Wahrheit aber alles nur noch viel paranoider macht; Michael Ritchies Downhill Racer mit Robert Redford als unterkühltem Skifahrer – amerikanischer Traum als sinnlose Talfahrt; Powell & Pressburgers Life and Death of Colonel Blimp auf BluRay und in jenen Farben, die dem Meisterwerk gebühren; Philippe de Brocas Homme de Rio ebenso, Paul Belmondo springt aus dem Fenster in Paris und schwimmt nach Rio.
Endlich am dritten Weihnachtstag mit Frau und Kindern Jon Favreaus Elf gesehen und auch wenn man sich in diesem Forum nur lächerlich macht, diesen Film anzupreisen, mach ich‘s trotzdem. Spaghetti mit Sirup, Kaugummis auf der Strasse, der beste Kaffee der Welt und echte Rührung dazu. Auch dieser Film war eigentlich das Geschenk eines Freundes: D. aus Berlin. Here‘s to you!
Ludger Blanke
2 kurze Reisen ans Rote Meer im Januar und im Dezember. Die Schönheit der arabischen Wüste und die komplexe Absurdität des Massentourismus an diesen feindlichen Orten. Ein besetztes Gebiet. Eine Welt ohne Frauen. Der Gedanke, das hier auf eine gefährliche Art überhaupt nichts stimmt, wie in einem Hitchcock Film, den ich mit 12 im Fernsehen sah. Jede Minute könnte ein Aufstand ausbrechen und die fantastischen Pools der Resorts würden sich rot färben vom Blut der Gäste. Die nicht ganz vollständige Gewissheit, das dies nicht passieren wird - zumindest bis zur Abreise in ein paar Tagen. Dazu die beruhigende Blödheit der bunten Fische in den Freiluftaquarien der Hausriffs am Ende des Stegs.
Emmanuel Carrere – Limonov. Auch eine Selbsterforschung des Autors, der sich ein paar mal fragt, was ihn dazu treibt, eine romantische Biografie über einen solch idiotischen Macker und Heldendarsteller zu schreiben.
Die surrealen 6 Minuten mit den 4 Toren zwischen der 22. und der 28. Minute am 8. Juli beim Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft zwischen Brasilien und Deutschland in Belo Horizonte. Toni Kroos Reaktion nach dem 0:3 – wie er schon gar nicht mehr wartet bis der Ball im Netzt zappelt, sich abwendet und die Hände fast vor Scham vors Gesicht hält. Die Zwischenschnitte auf die brasilianischen Zuschauer, die genau dasselbe tun und sich Tränen aus den Augen wischen. C, die in der Pause das Fenster öffnet und die blöd-trötenden Deutschland-Fans unten auf der Straße beschimpft.
Landing on a Comet, 317 Million Miles From Home
Das New York in Donna Tarts The Goldfinch.
Die Harfe Phil Cohrans auf African Skies.
Louis CK, Jerry Seinfeld und Yvonne Strahovski in Louie S04E02.
Wie an einem wunderbaren Tag im Herbst die Teens L und E sich gegenseitig Episoden aus Gossip Girl beim Spaziergang über die Brooklyn Bridge nach Manhattan erzählen und meine Hinweise auf die Grossartigkeit des Lichts, der Architektur, der Geschichte, der Perspektiven nach einem kurzen Blick mit einem Achselzucken abtun (und sich trotzdem noch in 20 Jahren an diese Augenblicke erinnern werden).
Meine plötzliche Verliebtheit in Susan Sontag in einer nicht einmal besonders gut gemachten HBO-Doku, die ich vor ein paar Tagen nachts auf dem Laptop sah. Wie sie am Ende glaubte, ihre Essays und politischen Texte seien wenig wert und nur ein gelungener Roman könnte sie in die Ewigkeit retten. Der Plan, beim nächsten Besuch in Paris Blumen auf ihr Grab zu legen.
Die schöne Perspektivverschiebung meines Umzugs von der Friedrichstrasse in die 8. Etage eines Sozialbaus aus den 70er Jahren in Gesundbrunnen. Wie viele Rätsel hier noch nicht gelöst sind.
Ich würde gerne einen Kometen nach Harun Farocki benennen.
Hannes Brühwiler
Ein eindrücklicher Kinosommer – mit der Filmgeschichte als Taktgeber: eine Robert Siodmak Retrospektive im Zeughauskino, gefolgt von meinem ersten Ausflug nach Bologna zum Il Cinema Ritrovato. Schließlich Locarno und die Titanus Retrospektive. Ebenfalls in Locarno gesehen, der vielleicht schönste aktuelle Film, Nuits blanches sur la jetée. Paul Vecchialis Farbfilm verwandelt einen Pier in eine traumhafte Bühne. In der Mitte des Films: definitiv die schönste Tanzszene des Jahres. Weitere Filme, die mir in den Sinn kommen: Adieu au langage (Godard), Boyhood (Linklater), From What Is Before (Diaz), Gone Girl (Fincher), Horse Money (Costa), The Iron Ministry (Sniadecki), Land Ho! (Aaron Katz & Martha Stephens), Love is strange (Sachs), The Midnight After (Chan), P’tit Quinquin (Dumont), Under the skin (Glazer), Worst Case Scenario (Müller).
Und: Empfindliche Wahrheit, ein wütender Roman von John le Carré, Feldeváye, ein weiteres Kapitel in Dietmar Daths phantastisch ausuferndem Universum. Das Cover des Albums LP 1 von FKA Twigs. Ein Gespräch mit Peter Liechti im Januar, nur wenige Monate vor seinem Tod. Am Ende des Jahres schließlich ein Besuch in seinem Büro. Alles fein säuberlich aufgeräumt, sein letzter Film bleibt unvollendet.
Robin Celikates
Auf Reisen: Ein paar Nachsommertage auf Elba, abends Fisch in der Osteria Del Noce in Marciana; auf der Suche nach tibetanischen und karibischen Restaurants in Queens (Phayul) und Brooklyn (Gloria’s – genau, das, in dem Tony Bourdain auf Omar aus The Wire trifft...); zwei Abende nacheinander in einem uigurischen Restaurant in Beijing.
Versuche über Kunst und Politik: zwischen Banalität und artifizieller Performance in Karlsruhe (Global Activism, ZKM) und Hamburg (The Art of Being Many, Kampnagel), viel eindrücklicher in Istanbul (Resistance and Resignation, SALT Galata) mit türkischen Künstlern und Aktivisten wie Vasif Kortun, Zeyno Pekünlü, Ali Taptık und Nazım Hikmet Richard Dikbaş – am Ende überwiegt leider die Resignation.
Besser als Citizenfour: Gespräche mit Gabriella Coleman, Jacob Appelbaum und Wendy Chun über Anonymous, Hacking, Countersurveillance...
(Wieder-)Gelesen: Nabokovs Invitation to a Beheading – das absurde Gefängnisschicksal des Cincinnatus C.; Ben Jellouns This Blinding Absence of Light – andere Gefängniswelt, andere Absurdität; Stasiuks 9 – in Warschaus neoliberal transformierter Unterwelt; Eribons Retour à Reims – the return of class, in überraschend persönlicher Weise; Chamoiseaus Texaco – postkoloniale Kakophonie aus der banlieue von Fort-de-France.
Michael Cuntz
Die ersten Folgen von True Detective, bevor alles Aufregende und Kompromisslose an der Serie in manichäischem Kitsch wieder zurückgenommen wird und aus einem Nihilisten ein Jesus wider Willen wird, der das puritanische Abendland gegen heidnisch-französische Kinderschlächter (OMG, Mardi Gras, gross!) und einen Abziehbildserienmörder verteidigt und so die matière de Louisiane denunziert, an der die Serie sich gelabt hat.
Manu Larcenets Tetralogie und Teratologie Blast, die dieses Jahr mit Pourvu que les bouddhistes se trompent ihren Abschluss gefunden hat und die bei jener Kompromisslosigkeit bleibt, für die True Detective zu wenig Mut und zu viel Kalkül hat. Visuell wie narrativ singulärer Wurf, ästhetisch ein ähnlich erratischer Block in der Bande dessinée-Landschaft wie der enorme Protagonist Polza unter seinen Mitmenschen.
Rafael Chirbes’ Roman En la orilla, eigentlich schon von 2013, aber erst Anfang dieses Jahres auf Deutsch erscheinen (Am Ufer), der keine exemplarische Illustration der spanischen Krise gibt, sondern eine auf allen Ebenen singuläre Rekonstruktion lokaler Kräfteverhältnisse, am Ufer von Meer und Sumpflandschaft, cañas y barro, mitten im Gedanken- und Assoziationsstrom des ebenso ortsgebundenen wie um jeden eigen Ort immer schon gebrachten Esteban. An- und durchgespielt werden alle möglichen ökonomischen Beziehungsformen. Von Anfang an aber bleibt kein Zweifel, dass hier, wie bei Zola und Céline, Raub und Plünderung die grundlegende Relation bilden.
Sommerhit, der auch noch im Winter gut klingt: Tony Allens und Damon Albarns Go Back
Robert Wyatts Anthologie Different Every Time mit Stücken aus den letzten über 40 Jahren, von denen man die meisten auch noch in fünfzig Jahren hören kann.
Ariel Pinks Lo-Fi -Epos Porn, Porn, schon für die Grant McLennan-Hommage Put Your Number In My Phone, aber auch, weil nach Zappa und Ween noch jemand da sein muss, der die Frage ob Humor in die Musik gehört mit Ja beantwortet.
Lost in the Dream von The War on Drugs, das oft klingt wie 80er Jahre Dylan, Springsteen und Roxy Music zusammen und nicht zuletzt deswegen so gut ist, weil Adam Granduciel immer wieder der Versuchung widersteht, zu seinen Liedern noch einen C-Teil dazu zu komponieren, der zwar mehr Abwechslung brächte, aber die Intensität des Stücks zerstören würde.
Silk Rhodes von Silk Rhodes setzt den Trend zum ganz kurzen Album (z.B. She Keeps Bees, Royal Blood, jeweils ganz knapp über 30 Minuten) am konsequentesten um (29:51) und erscheint so als ein Skizzenbuch und amuse-oreille. Es widmet seinen Trip einem vom DX-7 verdrängten Keyboard – vermutlich das wichtigste Instrument in der Popmusik, das nicht mehr gebaut wird. Die Musik klingt zum Glück wirklich so und wem zum Gesang (face 2 face) nur Pharrell Williams einfällt, kann auch mal in ein Album von George Duke reinhören.
Trouble in Paradise von La Roux, intelligenter Pop, der einem eine Hookline nach der anderen ins Ohr setzt anstatt einem ständig mit dem Arsch voran ins Gesicht zu springen.
...und No One is Lost von den Stars und In Conflict von Owen Pallett, für die das sowieso schon immer gegolten hat.
Die Musik von Bobby Womack, Charlie Haden und Nick Talbot
Catherine Davies
Eigentlich hatte ich schon Anfang August mit meiner Doktorarbeit fertig sein wollen, was mir aber dann doch nicht gelang; so verbrachte ich den Sommerurlaub schreibend, erlaubte mir aber trotzdem, in Konstanz die hochinteressante Ausstellung über das Konzil von 1414–1418 zu besuchen. Die dort ausgestellten Gegenstände des alltäglichen Lebens illustrierten sehr wirkungsvoll die materiellen Bedingungen und Kontexte dieses religiös-politischen Großereignisses; in ihrer Fremdheit bildeten sie einen hochwillkommenen Kontrast zu meiner sonstigen Beschäftigung mit Geschichte, die in den letzten Jahren hauptsächlich aus der Lektüre von Finanzliteratur des 19. Jahrhunderts bestand.
Nachdem ich Anfang September schließlich abgegeben hatte, besuchte ich das erste Mal seit Langem nachmittags eine Kinovorstellung und sah Dominik Grafs Geliebte Schwestern, für mich einer der schönsten Filme des Jahres. Bereut habe ich nur, dass es die Kinofassung war und nicht die deutlich längere Version, die im Februar auf der Berlinale lief.
Wenig später starb mein von der ganzen Familie sehr geliebter Onkel in München. Er, Dozent für Literaturwissenschaft, hatte mir vor vielen Jahren eine von ihm herausgegebene Anthologie deutscher Dichtung geschenkt, der ich einige der schönsten Leseerfahrungen meiner Schulzeit verdanke. An diese Lektüren musste ich zurückdenken, als ich kurz nach der Beerdigung in der SZ Lutz Seilers großartigen Text über seine Begegnung mit den Gedichten Georg Trakls las. Dies wiederum veranlasste mich, den Nachruf Albert Ehrensteins auf Trakl zu lesen, der in einer ebenfalls von meinem Onkel herausgegebenen Sammlung mit dem gleichzeitig schönen und mich plötzlich sehr traurig machenden Titel «Deutsche Abschiede» abgedruckt ist. «Sein Leben war stets umschattet gewesen», heißt es dort, «sanfte Melancholie vor dem Tod, den er immer sah, ein Hintaumeln vor der Verwesung, die er immer fühlte.»
Matthias Dell
1. Privilegiertes Reisen: Nordkorea, Pjöngjang. Acht Tage Filmfestival. Sehr filmisch, man kann aus fahrenden Bussen keine Fotos machen. Kulissengefühle. Absurde Texte. Der schöne Morgen bei geöffnetem Fenster im 35. Stock, rasselnde Boote, Rußgeruch. Die Abende an der Hotelbar. Angeguckt werden. Déja-vus von der anderen Seite. Am Tag vor der Abreise im fast leeren Changgwang Pool. 1600 Meter, weil wir auf den Fahrer vom Minibus warten müssen.
2. Theater/Kunst: Der Erste Europäische Mauerfall vom Zentrum für Politische Schönheit. White American Flags von Wermke/Leinkauf. Und: Damian Rebgetz im HAU. Something for the Fans als berührende Coming of Age-Geschichte entlang von Ventilatoren, mit schönem Unter-der-Dusche-Singen-Gesinge: I wanna dance with somebody. Das tollste Feature aber ist die Ice Age-Squirrel-Scrat-Grinse von Rebgetz. Später noch, etwas unwuchtiger, The Hooks mit der tollen Abkürzung GAS (Germany, Austria, Switzerland) und dem Udo-Jürgens-Plexi-Porno-Flügel. Zu dessen Ehren als Zugabe, natürlich: Liebe ohne Leiden. Wenn er das noch hätte erleben können.
3. Die WM. Manuel Neuer gegen Algerien. Toni Kroos' ungläubige Hände vorm Gesicht nach dem dritten Tor gegen Brasilien. Die Verarbeitung des 7-1 am Tag danach durch das Immer-wieder-Anschauen aller möglichen Kameraperspektiven. Die Erschöpfung nach dem Finale. Der Kater vorm Brandenburger Tor.
Jan Distelmeyer
In Basel im sehr schönen Mai, der Weg über den Fluss ins Stadtkino und dann dort: Upending der OpenEndedGroup, in dem der Ton das 3D-Bild informiert und Cinesapiens von Edgar Pêras, der alles und nichts von 3D will und darum lustig und frei fordern kann, Film müsse Realität werden und umgekehrt.
Die 10 Tore in den zwei Relegationsspielen (1:3 & 4:2) zwischen Darmstadt und Bielefeld, nach denen dann am 19. Mai um 23:03 bewiesen war, dass die Arminia immer noch führend ist, wenn es um maximales Drama und Leid in den unteren Regionen (früher mal der ersten Liga) geht. Die WM vier Wochen später ist eine ganz andere Sache.
Kelly Reichardts Night Moves und die Schönheit der Schwierigkeiten auf der Suche nach Alternativen (und vielleicht Vorbildern).
Die dichtenden, verzweifelten, witzigen und entschlossenen Frauen und Männer in den Miner’s Campaign Tapes von 1984, die ich im November im Hamburger Metropolis gesehen habe. Das Kino versteht sich da gut mit dem alten Video. Beide geben sich gegenseitig eine Kraft, die mich zu ihrer Sache und zugleich zu Freunden führt, die ich in diesem Jahr verloren und um die ich mich gesorgt habe. Im Kino geht der Kampf ganz gut aus, und so soll es auch sonst sein.
Monika Dommann
Filme
The Act of Killing. Von Joshua Oppenheimer – Die ganz grosse Kraft des Kinos basiert seit hundert Jahren auf Projektion und Reflektion. Die Strahlen des Projektors schiessen von der Leinwand direkt auf die Retina der Zuschauer zurück. Im Falle von Oppenheimers Reenactment der Massaker an ‹Kommunisten› in Indonesien zur Zeit des Kalten Kriegs schlägt das Leinwandlicht allerdings direkt auf den Magen. Dass der alte Schlächter in Oppenheimer den Amerikaner, den alten Verbündeten und das Rambo-Hollywood sieht, und sich deshalb dazu hinreissen lässt, seine Massenmorde nachzuspielen, bis es ihn selbst im Hals würgt: Solche Geschichtsschreibung vermag bloss das Kino zu leisten.
Vaters Garten – Die Liebe meiner Eltern. Von Peter Liechti – Der letzte Liechti. Leider. Zurück zum Anfang. Zum Schwierigsten, zum Befremdendsten. Zu den eigenen Eltern. In dieser Enge bleibt bloss Tier-Werden und Hardcore als Ausweg und Fluchtroute. Schlicht genial sind das Hasen-Puppentheater mit den Eltern und dem Sohn. Und der typische Liechti-Sound mit der unheimlichen Hammondorgel von Dominik Blum.
Citizen Four. Von Laura Poitras – Die Anatomie eines Coups. Laura Poitras hat den High Noon mit Edward Snowden im Sommer 2013 in Hong Kong in schönen paranoischen Bildern eingefangen. Der alte Ewen MacAskill ist nicht so doof, wie ihn Glenn Greenwald in seinem „No place to hide“ darstellt. Seine verschupften kleinen Fragen locken den klugen und bescheidenen Samurai Snowden aus seiner Nerdrüstung.
Texte
Der Bourgeois. Eine Schlüsselfigur der Moderne. Von Franco Moretti – Seit dem Börsencrash von 2008 finde ich mich, Tochter von kleinen Leuten, die nur unvollständig in den Mittelstand aufgestiegen waren, in den 1980er Jahren inmitten von Anarchismus und Punk gross gewordern, in der SVP-Schweiz letztlich als Verteidigerin bürgerlicher Werte und Institutionen wieder: Meiner Alma Mater, meiner Tageszeitung (NZZ), der guten Arbeit, dem gentlemanhaften Verhalten, der Privatsphäre jeder einzelnen. Moretti zeigt, dass man Digital Humanities auch mit Sinn und Verstand betreiben kann. Er arbeitet mit dem philologischen Seziermesser die Credos und Dissonanzen der Bourgeoisie des 19. Jahrhundert heraus: Harte Arbeit, clevere Findigkeit, politischer Wagemut, der aufkommende Antiintellektualismus im Viktorianismus, die bürgerlichen Sphäre, die abenteuerliche Verschlagenheit, Produktion und Destruktion, Wettbewerb, Heilsversprechen, Ernsthaftigkeit, Verschweigen, Hintergehen, Raffinesse, geschickte Manipulation. Kurz: Schöpferische Zerstörung.
Zwei Mal zur Kunst des Regierens:
The Quiet German: The astonishing Rise of Angela Merkel, the most powerful woman in the world. Von George Packer – Kohls Killerin. Oder die, die aus dem Osten kam, und oben bleibt. In epischer New Yorker Länge.
Mehr Punk, weniger Hölle! Von Constantin Seibt – Über den Mut der Bürger in Island nach dem Bankencrash, der auch den Staat und mit ihm seine Bürger an den Rand eines Bankrotts gebracht hatte. Eine poetische Hommage an ein politisches Krisenexperiment.
Ausstellungen
1900-1914. Expedition ins Glück. Von Juri Steiner und Stefan Zweifel im Landesmuseum Zürich – So müssen Ausstellungen sein: Ohne Museumspädagogik und interaktiven Touchscreens. Ein Eintauchen mit allen Sinne in den Rausch vor der grossen Katastrophe: Röntgens Schattenbilder, Freuds Traumdeutung, unzensurierte nackte Körper von Schiele und Klimt und das silberne, schnittige Glanzstück der Ausstellung: Der A.L.P.H.A 40-60 HP Aerodinamica von 1914.
Harun Farocki: Ernste Spiele. Im Hamburger Bahnhof Berlin – Die letzte Farocki Vorführung. Unbegreiflich. Bis zum Schluss fadengrade Bildkritik. Unvergesslich bleibt der Betrachterin, wie sie den Bildern, einmal mehr, auf dem Leim ging. Dass das, was sie sah, keine IT unterstützte Kriegstraumatherapie ist, sondern eine Werbeshow für Psychologe der United States Air Force.
Geld. Jenseits von Gut und Böse. Im Stapferhaus Lenzburg – Wie hast Du’s mit dem Geld? Das grösste Tabu im Land der Banken? Reden über Geld? Der Piketti-Effekt bringt hoffentlich Massen von Zuschauern ins Schweizer Mittelland! Zum Schluss zahlt jede, was die Ausstellung ihr wert war.
Christoph Dreher
2014 begann gut mit dem Symposium Autorenserien 2 an der Merz Akademie in Stuttgart. Es war deutlich, wie stark das Thema sich seit der ersten Tagung genau vier Jahre davor herumgesprochen hatte. Die amerikanischen Vortragenden Cathryn Humphris, Lolis Elie und Stewart Lyons, die als Autorinnen oder Produktionsleiter an Serien wie Treme, Mad Men oder Breaking Bad mitgewirkt hatten, zeigten sich sehr erfreut über die Anerkennung ihrer Arbeit, die sie in der Einladung zur Tagung und sehr positiven Resonanz auf ihre Vorträge wahrgenommen hatten.
Auf der Berlinale Nick Cave mit seinem schönen Film 20000 Days on Earth. Er empfahl Jonathan Glazers Under the Skin, der in Deutschland nicht in die Kinos kommen sollte, weil der Verleih das sinnlos fand. Ich konnte ihn dann doch auf dem Fantasy Filmfest auf einer großen Leinwand mit einer guten Tonanalage sehen und hören, eine sehr spezielle, großartige psychedelische Film-Erfahrung.
Retrospektive Film-Highlights des Jahres: La Ciénaga, La Nina Santa und La Mujer sin Cabeza von Lucrecia Martel mit ihren wunderbaren Bildwelten, und alle verfügbaren Filme von Johnny To, mit ihrem überbordenden visuellen und erzählerischen Reichtum.
Eine Art Überdruss stellte sich zur Mitte des Jahres hin ein: ich blätterte lustlos durch Plattenstapel, schon nach wenigen Exemplaren aufgebend, bis ich schließlich auch das gar nicht erst mehr anfing.
Und dann starb am 30.7. Harun Farocki – ein Schock. Zum herannahenden Silvester vermisste ich ihn besonders, hatten wir die letzten fünf, sechs Jahre den Jahreswechsel doch immer zusammen gefeiert.
Ebenfalls in liebevoller Erinnerung: Jack Bruce, Charlie Hayden.
Wenigstens die Lust an der Musik kehrt langsam zurück.
Daniel Eschkötter
Vorsatz: Versuchen, mehr über Filmmusik nachzudenken. Anlässe gab es genug: Brian Reitzells Hannibal-Gebimmel, Mica Levis Under the Skin-Nervensägen. Nach Inceptions Piaf-Geologie tatsächlich schon wieder eine bleibende Blockbustermusik von Zimmer, Minimal+Barock, die das analogapotheotische Melo-Uhrwerk von Interstellar der Nolans orchestro-synchronisierte; nach DiCaprios zerstaubenden Gedächtnispalästen nun Bibliotheken, Kathedralen der Erinnerung und Videozeugnissäulen für eine Zeit, in der noch Licht und Korn waren. Und natürlich Reznor/Ross, Gone Girl, die Weiterarbeit daran, bei und mit Fincher, so etwas wie genuin generischen Proceduralsound zu produzieren, dreimal gesehen, zigmal gehört. Minimaler Aufbau mit drei, vier Spuren, erstmal nur takten, nur Schläge, nur sonisch sein wollen; Rhythmusregime mit Minimoog, Marimba, schichten, mehr schichten, Gegenläufiges einbauen, Noise, Dissonanzen; abbauen, bis wieder nur noch zwei, drei Pluckerminimalspuren bleiben, dann ein neues Instrument, eine Harmonie, Melodie, die einen da schon fast aus dem Nichts trifft, z.B. im Stück zu »Clue Two«: zwei Streicher, die plötzlich ein echtes Thema einführen, dabei, im vierten Takt einsetzend, alles kurz symphonisch & bestimmt ummodellierend. Wie Fincher in seinen letzten zwei Procedurals platte Plots stoisch abarbeitet, darin & dabei an Binnenmechaniken baut – alles Struktur: wo ein Clue ist, kommt ein Post-it dran –, das hat fast alles mit diesen Arrangements zu tun, modelliert ihre Aufgespanntheit vor oder nach. Selbst das Schauspiel ist kakophon, gegenrhythmisch, dieser konzeptualistisch knirschende Cast aus allen Genreregionen und -registern. Und dazu krault Affleck die Katz wie weiland Blofeld. · Was sonst so alles war in diesem Leakjahr. Darunter der Vorsommer mit Pynchons, Broad Citys, High Maintenances, Washington Squares, Box Kites, Rockaways NY. Aufgehobensein immer wieder, zwischendurch, in der avancierten Asozialität von It’s Always Sunny in Philadelphia. Die Postpunkpräzision von DIE NERVEN. Open Mike Eagles live geloopte »Dark Comedy«. Dean Blunt J. Cole Run the Jewels Shabazz Palaces TV on the Radio. Und nun: 2014, shake it off.
Ralph Eue
Februar (Berlin, Wien) – Notiz übers Notizbuch: «Steinbruch, Schrottplatz, Abfallhaufen für Sprachreste, Bilddreck und ausgelagerte Gedächtnisteile. Hält Erinnerungsbrocken für eine kommende Materie bereit. Darf keine weißen Flecken aufweisen. Setzt auf das Abschwellen einer aktuellen Hysterie.» (Heinz Emigholz: Zeichnung oder Film. 44 Blätter und Legenden aus Die Basis des Make-Up) In diesem Zusammenhang auch: «Ich schreibe, um herauszufinden was ich denke», was der deutsche Titel des zweiten Bands der Tagebücher von Susan Sontag ist. Fast ein Mission Statement ihrer Arbeit als Essayistin: «Nicht vertraut sein, mit dem, was ich tue.»
März (Los Angeles) – Begegnung mit Michael Silverblatt, der allwöchentlich eine phantastische Literatursendung (Bookworm) im amerikanischen Privatradio macht – einstündige Gespräche mit jeweils einem Autor: «Something that is dramatically missing nowadays in cinematic production, a stubborn indifference of artists towards critics and public opinion. Terrence Malick is the only one around who has kept this indifference.» Ob es in Deutschland so jemanden gäbe? Mir fällt keiner ein.
Juni (Berlin-Nürnberg-Berlin, ICE) – Früher sagte man: eins muss man dem Hitler lassen, er hat die Autobahn erfunden. Unverzichtbar zu ergänzen, dass er es auch geschafft, den Deutschen das Vollkornbrot als gute Sache aufzuquatschen: Über den Reichsnährstand. Hilfreich bei der administrativen Durchsetzung: die Reichsarbeitsgemeinschaft für Volksernährung (ab 1933), der Reichsvollkornbrotausschuss (ab 1939) und die Gausachbearbeiter – interessant, dass die Rechtschreibprüfung meines Textverarbeitungsprogramms dieses Buchstabengebilde als korrekt erkennt – für die Vollkornbrotaktion (ebenfalls ab 1939). Die o.g. Sachbearbeiter sorgten auch dafür, dass in wenigen Jahren zehntausende Vollkornbäckereien in Deutschland eröffneten («Reichsaktion für die Hebung des Vollkornbrotverzehrs»). Aus einer der Schriften dazu: «Das Brot ist ein heiliger Begriff. In ihm lebt der Geist vom Urquell der Kultur und der Urkraft unserer Rasse.» Es gab in diesem Zusammenhang auch eine Schrift, die hieß «Nationalsozialistische Forderungen an das Brot».
Juni (Mannheim) – Mannheim hat die positiven Eigenschaften der Bundesrepublik vor der Wende bis in die Jetzt-Zeit gerettet. In Mannheim auch, Antwort von Matthias Lilienthal (Theater der Welt), ob er generell sagen könne, was ihn eigentlich interessiere am Theater: «Ich kann einfacher sagen, was mich nicht interessiert: meine eigenen Vorurteile.»
Juli + August (Leipzig) – Sichtungsplatoon fürs Dokumentarfilmfestival in Leipzig. Gleich morgens am 31.07. die Nachricht, dass Robert Drew tot sei. Ob ich einen Nachruf für die Website schreiben könne. Dass er sterben würde war zu erwarten. Wenn es dann passiert, überfährt es einen dennoch. Binsenweisheit, gewiss. Aber trotzdem!
2011 war Bob Drew, damals schon sehr krank, in Leipzig gewesen. In der Erinnerung die Begegnung mit einer Legende. Seine besten Witze waren die über Richard Leacock, und dass er (Drew) immer in seinem (Leacocks) Schatten gestanden hat, obwohl er (Bob) doch viel zu dick sei, als dass er im Schatten des spindeldürren Rickie überhaupt hätte verschwinden können. Brave men are funny! Gemeinsam haben sie (+ Pennebaker + Maysles) Primary gedreht und Crisis: Behind a Presidential Commitment. Und etliche andere. Danach der besagte Schatten. Ego fighting. Dann viele verschiedene Einzelwege. Schillernd alle.
Der Text war noch nicht zu Ende geschrieben, als mich die Nachricht erreicht (ich glaube über MONOPOL), dass Harun Farocki tot ist. Erst Unglaube, dann Entsetzen, wieder Unglaube, schließlich Lähmung! Seltsam, dass die Meldung eine ganze Weile allein für sich stehen bleibt im Netz. Bis Mittag keinerlei virale Streuung. Die Kulturradio Redakteurin Petra Castell, der ich die Meldung weiterleite, weil wir eine Sendung zu Haruns kommender Ausstellung «Eine Einstellung zur Arbeit» geplant haben, findet anderthalb Stunden lang keine weitere Quelle, die die Todesnachricht verlässlich bestätigen würde. Etwas Ungreifbares wie bei einer Sonnenfinsternis: Unglaube-Entsetzen-Unglaube-Lähmung. Obwohl um etliches älter als ich selbst, ertappe ich mich dabei, wie ich eine kindliche Beschwörungsformel aufsage: er ist doch viel zu jung! Alles sträubt sich, die Nachricht anzunehmen. Erinnerung an einen Berlin-Marathon vor langer Zeit. Am Abend zuvor eine nicht sehr erquickliche Sitzung der Filmkritik. Es war schon ziemlich gegen Ende des regelmäßigen Erscheinens der Zeitschrift. Wir haben alle sehr viel geraucht. Wenn ich mich richtig erinnere überwiegend Roth-Händle. Den Marathon verfolgte ich als Zuschauer. Und das auch nur mit Mühe. Mir war elend. Harun lief mit. Sein Lauf schien so unangestrengt. Vitalität pur.
In diesem Jahr wurde überhaupt viel zu viel gestorben: Michael Glawogger (23.April), Helma Sanders-Brahms (27. Mai), Florian Flicker (23. August), Peter von Bagh (17. September). Ebenfalls in den Big Sleep eingetreten, Philip Seymour Hoffmann (2. Februar) und Lauren Bacall (12.August). Schöne Huldigung dessen, was letztere verkörperte: «… die inzwischen leider immer weiter verblassende Erinnerung an die Freiheit, die sich ihr Land, die USA, in besseren Tagen einmal geleistet hat.» (Süddeutsche Zeitung)
September (Wien, Leipzig) – Im Keller: Beeindruckt von der kinematographischen Zurückhaltung, die sich Seidl auferlegt und durchhält. Der einzige Film des Jahres, der mich bewundernd zurücklässt. Unaufgeregtes Furchenziehen auf dem Feld des Grotesken. Mit den automatisch einschnappenden Reflexen von Zustimmung oder Ablehnung kommt man in diesem Film nicht weit. Mit souveräner Zurückhaltung werden unterschiedlichste Kellermomente in Szene gesetzt und zu meisterlich grotesken Tableaus arrangiert. «Der Keller», sagt Ulrich Seidl, «ist in Österreich ein Ort der Freizeit und der Privatsphäre. Viele Österreicher verbringen mehr Zeit im Keller ihres Einfamilienhauses als im Wohnzimmer, das oftmals nur zu Repräsentationszwecken dient. Im Keller gehen sie ihren eigentlichen Bedürfnissen nach, ihren Hobbys, Leidenschaften und Obsessionen.» Dass bloß niemand glaube, die Groteske sei eine Gattung minderer Art! Sie ist unter den Künsten vermutlich nur das, was in der Architektur des Hauses der Keller ist. Der große russische Kulturphilosoph Michail Bachtin hat der Groteske in seinen Büchern schönste Kränze geflochten, unter anderem so: «Der klassische Realismus stellt die Wirklichkeit dar, wie sie den Normen einer kulturellen Ordnung nach sein sollte, der groteske Realismus zeigt die Wirklichkeit, wie sie trotz dieser Ordnung existiert.»
Oktober (Berlin) – Im Archiv der Akademie der Künste. Transkript einer Veranstaltung mit Heiner Müller, Hans Jürgen Syberberg, Edith Clever, Susan Sontag, Werner Stötzer, Bernhard Sobel und Klaus Theweleit (1990). Heiner Müller über Hans-Jürgen Syberberg: «Syberberg ist ein großer Künstler, da hab ich überhaupt keine Zweifel. Und wenn er im Politischen ein Idiot ist, spricht das nicht gegen seine Kunst. Ich bin ein technischer Idiot, ich kann keinen Fernseher bedienen. Das spricht auch nicht gegen meine Texte.»
Jahresende (Berlin) – Ein weiteres Jahr, in dem ich nicht ein einziges Mal eine Pressevorführung besucht habe. Ein Versäumnis
Alexander Gehlsdorf
Ich bin im Nachhinein überrascht, dass es mir trotz Umzug und mehreren Theaterengagements möglich war, ein so großes Serien- und Literaturpensum anzusammeln. Durch die Beteiligung an einer Tschick-Inszenierung in Cottbus habe ich drei Romane Wolfgang Herrndorfs verschlungen, von denen Arbeit und Struktur sicher den stärksten Eindruck hinterlassen hat. Zudem habe ich mich über einen Zeitraum von 4-5 Monaten durch die gesamte A Song of Ice and Fire-Buchreihe gearbeitet, welche die Serie Game of Thrones deutlich in den Schatten stellt und auch den direkten Vergleich zur diesjährigen, erstmals vollständigen Lektüre von The Hitchhikers Guide to the Galaxy mühelos gewinnt.
Im Serienbereich startete das Jahr stark mit der dritten Sherlock-Staffel, der Abschluss der Hobbit-Trilogie zeigte jedoch, wie auch seine beiden Vorgänger, dass Cumberbatch und Freeman nicht automatisch Qualität garantieren, der Veröffentlichung der finalen Extended Edition fiebere ich dennoch entgegen, um endlich die Arbeit an einem dreistündigen FanEdit zu beginnen, um den Film letztlich doch noch zu dem zu machen, was sich aus den veröffentlichten 9 Stunden Rohmaterial nur erahnen lässt.
Ähnlich dualistisch endeten zwei meiner Lieblingsserien – How I Met Your Mother nach der schwachen letzten Staffel überraschend kontrovers und Boardwalk Empire um Längen besser und runder als von mir erwartet. Abgeschlossen ist nun nach langer Zeit nun auch meine Doctor Who-Aufholjagd, sodass ich endlich ohne Spoilergefahr meine Zeit auf tumblr vertrödeln kann. Das Highlight des Jahres dürften allerdings der deutsche Netflix Start und in diesem Zusammenhang die beiden Orange Is The New Black-Staffeln darstellen. 2015 steht also ganz im Zeichen der Vorfreude auf die dritte Staffel und natürlich einer neuen Star Wars-Episode, der ich nach dem aktuellen Trailer nach wie vor mit großem Optimismus entgegensehe.
Abgesehen von der Entdeckung der Berliner Band Tonträger, der Veröffentlichung des tollen, aber nicht weltbewegenden Jazzalbums von Lady Gaga und Tony Bennet und Rob Cantors Soloalbum Not A Trampoline hatte das Jahr musikalisch für meinen Geschmack wenig zu bieten. Ein neues Joe Hawley-Soloalbum blieb entgegen aller Erwartungen ein Wunschtraum, der Erfolg von Rob Cantors Live Version von Shia LaBeouf macht aber immerhin Hoffnung, dass Tally Hall nicht für immer bloß ein Geheimtipp bleiben muss.
Christoph Haas
Comic
Stefano Ricci: Die Geschichte des Bären
Bruno, der «Problembär», sein trauriges Schicksal. Anthropomorphe Tiere, die als Rettungssanitäter unterwegs sind. Zwei alte Männer und ihre Erlebnisse während der Mussolini-Zeit. Eine italienische Stadt und die Wälder der Ostsee. Heterogenes ist in «Die Geschichte des Bären» so mühelos und schlüssig miteinander verknüpft, wie es sonst nur Träumen gelingt.
CD
Martin Carr: The Breaks
Der frühere Kopf der Boo Radleys; fast 20 Jahre, nachdem seine Band mit «Wake up!» an der Spitze der englischen Charts stand, legt er jetzt das Soloalbum vor, das man sich von ihm immer erträumt hat. Britpop ain’t dead, it doesn’t even smell funny.
Film
David Cronenberg: Maps to the Stars
Hollywood Babylon, das war einmal. Hier ist Hollywood ein Ort der ewigen, lähmenden Wiederkehr, des permanenten Recyclings. Am Ende bleibt nur, wie in den Fleurs du mal, der Aufbruch in den Tod – «pour trouver du».
Günther Hack
Film 2014: Grand Budapest Hotel von Wes Anderson, ein medienboardgefördertes Spiel mit den zahlreichen gescheiterten Weltkriegs-Reenactments des vergangenen Jahres. Ein schmerzfreier Film, der an mir vorbeiblödelt und -emotionalisiert und gerade deshalb so gut in eine allgemeine Stimmung passt, in der alles, wirklich alles zur Selbstverständlichkeit wegnormalisiert wird – Folter, Invasionen und Tod –, in der es keinen Sinn mehr ergibt, Weltkriege noch durchzunumerieren. Ich hoffe auf die Fortsetzung «Second Grand Budapest Hotel».
Tier 2014: Traurige Trappen. Ende November verbreiteten afghanische Sozialmedien-Accounts das Bild eines toten Vogels mit einer seltsamen Apparatur und einer Antenne am Rücken. Die Information dazu: Die afghanische Polizei habe das von den Taliban mit einer Bombe versehene Tier, gewissermaßen eine bewaffnete Bio-Drohne, erfolgreich abgeschossen. Tatsächlich handelte es sich um eine seltene asiatische Kragentrappe (engl.: Houbara Bustard), die im Rahmen eines Umweltschutzprojekts mit einem GPS-Sender ausgestattet worden war. «Foreign Affairs» wiederum wusste vor längerer Zeit zu berichten, dass die CIA 1999 den bereits damals gesuchten Osama bin Laden im Süden Afghanistans lokalisiert hatte – in einem Kragentrappen-Jagdcamp. Die Kragentrappen sind beliebtes Jagdwild reicher Falkner aus den arabischen Staaten, die den Vogel in ihrer Heimat mittlerweile beinahe ausgerottet haben und schon aus Liebe zur Kontinuität ihres eigenen Hobbys Initiativen zum Schutz des Vogels finanzieren, Initiativen, die Trappen mit GPS-Sendern ausstatten, welche für afghanische Polizisten wie ferngesteuerte Bomben aussehen. Der Al-Qaida-Chef wiederum sei damals nur deshalb von der CIA verschont worden, weil ein Angriff auch das Leben seines adligen Gastgebers gefährdet hätte. Die Globalisierung als Sache der Jäger. Suchet die Nähe der Prinzen.
Gemüse 2014: Karotte.
Martin Heckmanns
Theaterstücke, deren Lektüre mir aus diesem Jahr in Erinnerung bleibt:
Wolfram Höll, Und dann.
Anne Lepper, La Chemise Lacoste.
Noah Haidle, Mr. Marmalade.
Juan Mayorga, Der Junge in der Tür.
Nolte Decar, Das Tierreich.
Hannes Becker, Der unsichtbare Fluss.
Wolfram Lotz, Einige Nachrichten an das All.
Elfriede Jelinek, Die Schutzbefohlenen.
Jakob Bidermann/Bernt von Heiseler, Philemon, der fröhliche Martyrer.
Inszenierungen:
Pippo Delbono, Orchideen.
Oliver Frljić, Zoran Đinđić.
Und Eindrücke aus Kuba:
http://www.logbuch-suhrkamp.de/werkstatt/martin-heckmanns-kuba-notizen-mai-2014-teil-16-und-26
Stephan Herczeg
1. Ein Jahr des Stillstands. Zu träge und unentschieden gewesen, um Veränderungen herbeizuführen, gleichzeitig aber auch froh, dass nichts Bedrohliches unvorhergesehen über einen hereinbrach. Prägeriatrische Ängste. Filme über das Altern und Älterwerden kamen deshalb bei mir besonders gut an: Maps to the Stars von Cronenberg und – für mich der beste Film des Jahres – Die Wolken von Sils Maria von Assayas. Aber auch Bonellos Saint Laurent war super und Zwei Tage, eine Nacht der Dardenne-Brüder sowieso. Wie Marion Cotillard, die ich eigentlich zu dünn für die Rolle fand, immer wieder denselben existenzbedrohenden und demütigenden Lebensmist vor ihren Kollegen abspulen musste, das kam mir so ungeheuer bekannt und realistisch vor, ohne genau zu wissen woher.
2. Fußball-WM-Nebensächlichkeiten: Podolskis Instagram-Bromance-Fotostream. Wie er immer mit seinen übermuskelten Oberschenkeln angeben musste. Wie Özil als einziger bei der Pokalverleihung halbnackt auf der Tribüne stand , weil er direkt nach dem Endspiel sein Trikot an Rihanna verschenkt hatte, die aus nicht näher erklärbaren Gründen plötzlich Fan der deutschen Mannschaft geworden war. Die Promigeilheit der Prominenten. Wie die hunderttausendfach medialisierten Fußballspieler auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor mit ihren eigenen Handys Videos und Selfies von sich aufnahmen.
3. Diesen Sommer gab es besonders schöne, mächtig aufgebauschte, sehr weiße und schnell vorbeiziehende Wolken vor tiefblauem Himmel, wie ich sie seit meiner Kindheit nicht mehr wahrgenommen hatte.
Jakob Hesler
Eine Filmentdeckung – Wang Xiaoshuai, Elf Blumen. Aus dem Nichts bei einer Routinesichtung in eine andere Welt gestolpert, eine Kindheit in der Kulturrevolution
Ein Kinomoment – Christopher Nolan, Interstellar. Im Imax, 70mm. Eine ratternde Wucht, mal abgesehen vom Film
Ein Bild – Meister Francke, Martertod des Hl. Thomas. Ein entsetzlicher Augenblick bewusster, böser Gewalt
Ute Holl
Mai: Reise nach Jerusalem, Tagung auf Mount Scopus, «Intentionally Left Blank», über Ausgelassenes, Lücken, weiße Seiten, weiße Flecken auf Karten, Weißbilder. Es klingt wie Left B_ank, intentionally, Grenzen die gemacht sind, um immer wieder aufzuspringen, mit Gewalt. Auf dem Weg vom Flughafen, im Halbschlaf, Nomadenzelte gleich neben der Autobahn. »C'est l' idée du nomadisme, tout simplement [...] un utopie. Au moins qu'on arrive à un point où le capitalisme ruine la planète.«. Wandern über die Dächer von Jerusalem. Alles leuchtet. Das Pferd Buraq schüttelt seine Mähne. Orthodoxe Juden wohnen da oben in einer selbstgebastelten Hütte. Fahrradwracks davor. Ein Stadtführer kommt uns im Kafka-T-Shirt entgegen. Die Stille vor dem Gesetz. Im Juni explodiert alles. Geschichte rückwärts: Entführungen, Bombardierungen, kein Wasser in Gaza, Sirenen in Tel Aviv. Die Weißbilder in Hatufim sind aufgerissene Spiegelachsen zwischen Israel | Palästina. (Simon Rothöhler alles andere als enthusiastisch zur Idee, ein booklet zu schreiben. Ok.) Verregneter Sommer. Ted Gaier wird 50, die Goldenen Zitronen projizieren Moses und Aron zur Tour Who’s bad? Goldene Kälber für immer nicht älter. In der Dämmerung Nomaden. Farocki stirbt. Das Dämmern ist in meinem Kopf. Die Frankfurter wollen wissen, wo Frankfurt ist. Ein Hamburger Gewerkschafter setzt sich für das Arbeitsrecht von Migranten ein. Am Schauspielhaus inszeniert Nicolaus Stemann Jelineks Schutzbefohlene. Nach Aischylos mit Lampedusa Leuten. Die Inszenierung verläuft an Spiegelachsen von Rampen und Kulissen: wer spielt wen und was wem vor. Scharf auf des Messers Schneide, gut getrieben von Jelineks Rhythmen. Die Frage ist nicht mehr die nach dem Volk, sondern nach einer politischen Intervention, die ganz und gar unheroisch ist. Auf der Bühne verhandeln, was davor nicht mehr auszuhalten ist. Für den Dezember werden wir auf das Dritte Internationale Filmfestival nach Duhok eingeladen und wieder ausgeladen: Due to the political situation in Iraq and the resulting humanitarian situation in the secure autonomous region of Kurdistan, The Duhok 3rd International Film Festival is postponed to September 9th, 2015. Thank you for your understanding. Wir kaufen einen Teppich und ersetzen darauf das Reisen. Der Kapitalismus hat den Planeten nun ruiniert. Nomadismus an Autobahnen, auf Autobahnen und allen Wasserstrassen. «Jetzt mögt bedachtsam, ungestörten Ernstes ihr, Den Blick zum Ufer, unverwandt zu den Göttern flehn. Ich aber will euch Hilf und Schutz zu holen gehn.» Von 2014 bleiben jede Menge unerledigter Dinge. Dagegen ist ein sehr schönes Buch zur Migration erschienen: Kracauer. Fotoarchiv. Herausgegeben von Maria Zinfert, Zürich-Berlin 2014. Lili und Siegfried Kracauer, 13 Jahre staatenlos nach ihrer Flucht aus Europa, halten sich gegenseitig fotografisch fest. Von Lili sind außerdem präzise Stadtszenen, Demolition-Fotos, versammelt. Unter den Begegnungen mit amerikanischen Freunden auch eine mit Maya Deren, in Schwung (S. 202).
Dominik Kamalzadeh
2014 kaufe ich einen Beamer. Beim Erstversuch projiziere ich Gareth Evans’ brachiales Hochhaus-Prügeldrama THE RAID auf die Wand ins Wohnzimmer. Die Verdunklung im Zimmer ist noch verbesserungswürdig. Wenn man wollte, könnte man von der Gasse aus mitansehen, wie die Knochen brechen, die Körper ausbluten. Ich habe ein mulmiges Gefühl dabei. Ein halbes Jahr später habe ich die Sache professionalisiert. Ich hole Ossama Mohammeds Dokumentarfilm SILVERED WATER, SYRIA SELF-PORTRAIT nach. Diesmal komme ich selbst ins Stocken. Der Film setzt mir zu. Ich muss ihn unterbrechen, mehrere Anläufe nehmen.
Zwei Gründe fürs Kino: Niemand kann reinschauen, niemand die Bilder unterbrechen.
Auf dem Festival von Locarno. Nach hartnäckigen Korrespondenzen via Deutschland und die Philippinen kommt die Zusage zum Interview mit Lav Diaz. Wir treffen uns in einer Pizzeria auf der Piazza Grande, ich glaube, es war 10 vormittags. Als ich ankomme, sitzt Lav Diaz noch mit dem Chef des britischen DVD-Labels Second Run zusammen. Später erzählt er mir, wie viel Pfund es verschlingen würde, seine Filme auf diese Art zu vertreiben. Wir rechnen gemeinsam hoch. Bei der Endsumme lacht Lav Diaz auf. Allerdings nicht verbittert, sondern amüsiert – über eine absurde Zahl, mit der man seinen Filmen, die sich über so viele Vorgaben hinwegsetzen, nicht näher rückt. Das macht er dann im Gespräch noch öfters, etwa wenn er erzählt, wie er mit MELANCHOLIA einen völlig anderen Film drehte, als er geplant hatte. Ich denke: ein freier Mensch.
Mit Kyra in Chania. Wir sitzen in einem Cafe, im Meer flunkert die Sonne. Wir bekommen ein SMS. Das erste Mal seit Tagen sind wir erleichtert.
In der Nacht schaue ich bei stummgeschalteten TV fassungslos dabei zu, wie Brasilien untergeht.
Birgit Kellner
2014: Vergessenen Anfängen nachspüren, darüber nachdenken, was heute ein solcher werden könnte. Auf meiner Festplatte speichere ich im Februar einen Abrieb der Grabinschrift von Orazio della Penna (1680-1745). Der Grabstein mit zweisprachiger Inschrift (Latein/Nepal Bhasa) steht in Patan, Nepal. Der Kapuzinermönch Della Penna erstellte ein Tibetisch-Italienisch-Wörterbuch mit 35,000 Einträgen (später ins Englische übersetzt, bald überholt und vergessen), doch seine Übersetzungen dogmatisch-philosophischer Werke sind verloren. Auch die einsichtsvollen Schriften von della Pennas Zeitgenossen Ippolito Desideri, eines Jesuiten, zu Geschichte und Religion Tibets gerieten in Vergessenheit, blieben aber in den Vatikanarchiven erhalten und wurden im 20. Jahrhundert neu herausgegeben.
Im März 2014 saß ich in einer Stipendienvergabekommission in den USA. Eine ambivalente Erfahrung. Noch selten habe ich so viel Professionalität, Aufmerksamkeit und Feingespür im Umgang mit Anträgen von Doktoranden erlebt, gleichzeitig noch seltener eine so klare und doch unreflektierte Vorstellung davon, in welche Formen sich Wissenschaft einzupassen hat. Wissenschaft, die kein «Narrativ» entwickelte, keine «Story» erzählte, kam nicht in die Nähe von Förderungswürdigkeit. Editionen, Übersetzungen, Glossare, analytische Studien, eng an sprödem Material gearbeitet? Nicht genug. Wie viel von dem, was heute in solchen Formen an Grundlagenwissen über andere Kulturen und Historien geschaffen wird, wird vergessen werden, weil es keine Geschichte erzählt, selbst, wenn es auf Englisch publiziert wird? Aber auch: Wie viel von dem, was heute als Geschichte gepriesen wird, wird dereinst als Glättung des epistemisch Gebrochenen, des eigentlich nur in Fragmenten Erkennbaren, im Dienste narrativer Dramaturgien entlarvt und dem Vergessen anheim gestellt werden – oder umgekehrt als künstliche Dramatisierung des Banalen unter Vorgaben des heroisch Erzählbaren? Werden die eingängigen Erzählungen vergessen werden, oder die Formen, die sich narrativer Logik widersetzen?
Im August fotografiere ich das Haus Goethestraße 12 in der Heidelberger Weststadt, erbaut 1906. Hier lebte und arbeitete, wahrscheinlich ab 1920, der Indologe und Buddhismusforscher Max Walleser (1874-1954), habilitiert, zum Extraordinarius ernannt, nie in den Rang eines ordentlichen Professors erhoben. Walleser schrieb über die Philosophie des indischen Buddhismus, als man dessen Literatur noch kaum kannte; er war zu früh dran, zu ungeduldig, zog zu große Schlussfolgerungen aus ungeeignetem Material. Er kämpfte um die Anerkennung seines Faches, er kämpfte mit Schüben, er kämpfte mit und in psychiatrischen Kliniken, er kämpfte mit nationalsozialistischen Universitätsverwaltungen, und er kämpfte dabei auch, wie ich erst unlängst erfuhr, um seine schwer behinderte Tochter.
Sarah Khan
1. Dem Tod von Frank Schirrmacher folgte eine wahnsinnige Textwelle, sogenannte Nachrufe, für mich die unglaublichste Lektüre des Jahres 2014. In den Bemühungen vieler Nachrufenden, persönliche und emotionale Augenblicke mit Schirrmacher einmal noch festzuhalten, wurden Rollen und Grenzen kurz vergessen, und seltsame Geschichten kamen zutage. Wie Schirrmacher einmal nach Pompeji fuhr, um die Ausgrabungsstätte doch nicht zu betreten; wie er den Kindern seiner Angestellten Spielzeugautos schenkte; wie er einem melancholisch gestimmten Moment Mathias Döpfner am Jungfernsee bei Sacrow aufmunternd zuspricht: «Wir sind nicht die alten Löwen im Zoo. Im Gegenteil: Das ist unser Leben.» Man sollte die vielen kleinen Geschichten aus den Nachrufen herauslösen, nacherzählen und ausschmücken, vielfältig und spekulativ, auch um herauszufinden, wie sie am besten funktionieren, ob als Ritter-, Idioten- oder Schauergeschichten. Allein die Traueranzeige der Witwe Rebecca Casati war der Hammer, solch ein todesverachtendes Liebespathos hat es in den letzten 200 Jahren deutscher Lyrik nicht mehr gegeben, das wurde auch viel zu wenig gewürdigt, dieses «du hast uns nicht verlassen, wir werden dich nicht verlassen, wir werden immer zusammen sein.» Das war quasi von mittelalterlicher Güte und ging mir tagelang nicht aus dem Kopf.
2. Sah dieses Jahr so viele Serien wie noch nie. Das ist zwar eine relativ angenehme Art den späten Abend zwischen 22 und 1 Uhr zu verbringen, gleichzeitig ist es unheimlich, soviel Lebenszeit fürs reine Glotzen dranzugeben, und ständig der Gedanke, was ich stattdessen hätte tun können. Lesen? Revolution machen? Liebe? Der Hype um «Serien als neue Romane» soll doch nur die Schuldgefühle dämpfen, fürchte ich, deshalb würde ich sowas blödes meinen Büchern nie erzählen. Mittlerweile schreibe ich eine monatliche Fernsehserien-Kolumne für Andy Warhol´s Interview Magazin, und das Gefühl zu arbeiten und zu recherchieren, während ich Serien gucke, ist das am besten auszuhaltende. Doch scheint das nur ein kleiner Teil der Wahrheit, sagte die Sardine, als der Hai sie fraß. Nashville 1 & 2, Homeland 4, Game of Thrones 4, The Fall 1 & 2, Saxondale 1 & 2, Plebs 1, House of Cards 1 & 2, American Horror Story, The Fades, Louie CK, Real Humans 1.
3. Seit einem Jahr spiele ich Altblockflöte und nehme wöchentlichen Unterricht. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Rainer Knepperges
Es passiert erst seit ein paar Jahren, gilt aber schon als alte Tradition. Der Gottesdienst der Karnevalisten im hohen Dom zu Köln ist immer Anfang Januar. Das erhebende Schauspiel beginnt mit dem Hineintragen der Fahnen, Banner und Standarten durchs Mittelschiff bis hinein ins Chorgestühl. Dort nehmen die zahlreichen Vertreter der Karnevalsvereine Platz, alle in ihren bunten Uniformen, einer oder zwei in Ritterrüstung. Nach Segnung und Entzünden der Karnevalskerze, Schuldbekenntnis, Vergebungsbitte, Lesung und Predigt, bekam diesmal der Traditionserfinder, der aus dem Amt scheidende Kardinal Meisner vor dem Altar ein Fässchen Kölsch überreicht und tauschte spontan seine Kardinalsmütze gegen eine Kappe der blauen Funken. Zu den Blasorchesterklängen der "Domstädter" wurde noch nach Schluß der Messe im heiligen Dom weitergesungen und geschunkelt: «Ich möch zo Foß noh Kölle jon» - ... - «Du bess die Stadt», am Rhein, dem grauen Strom.
Das stolze 16 Jahre alte Festival des psychotronischen Films, mit dem irreführenden Beinamen «Besonders wertlos», fand zum zweiten Mal in Köln, im Filmhaus statt. Im hochattraktiven Programm war Wenzel Storchs autobiografische Lesung und Dia-Show der Höhepunkt. In trockensten Worten und bizarrsten Bildern entfaltete sich erst eine schockierende Milieustudie Hildesheims, dann ein schmerzliches Selbstportrait des Barock-Filmemachers, und zum Nachhausenehmen blieb das Gefühl des Eingeweihtseins in die heilige Trinität von Katholizismus, Kunst und Komik.
Der 13. Hofbauer Kongress war mein erster. In Nürnberg und Fürth, im Kreise der aus Aachen und Berlin und München und von Weißgottwoher angereisten, erlebte ich nun endlich, was sogar in den besten Zeiten des Filmclub 813 so ausschweifend nicht vorkam, eine kollektive Genusshaltung, ein bedingungsloses Sich-jedem-Film-ausliefern, ein gemeinsames Reveupassierenlassen in den Pausen, Schwelgen in Verwunderung, Staunen im Halbschlaf, die ganze Nacht hindurch. Bis es – morgens um sieben – draußen längst hell ist, und die Welt wieder in Ordnung.
Ekkehard Knörer
Mit Gary durch Queens, Miriam und Dorle und Werner zu Besuch in Berlin, Birthe und Danilo und (introducing:) Stephan in Paris, Janet und Bob in Austin, Elisabeth und Ulrich in Frankfurt zu Silvester und Maud und Jörn, Nacim und Andreas in Chicago. (Freunde, out of town)
Mit Dietmar Dath in Hannover. Patti Smith im Springer-Hochhaus. John Sayles in der Brooklyn Academy of Music. Bonnie Prince Billy in der Apostel-Paulus-Kirche. Wolfram Lotz bei Prosanova. Marissa Nadler im Roten Salon. Philippe Jaroussky im Konzerthaus. (Auftritte)
Lamm mit Kreuzkümmel im Rural Restaurant in Flushing. Rindfleisch in Chili-Brühe im Da Jia Le in der Goebenstraße. Das Lieblingsessen der Chefin in der Peking-Ente in der Wilhelmstraße. Dim Sum im Triple Crown in der Chinatown in Chicago. Wan Tan in Chiliöl im Lon Men in der Kantstraße. Der Karpfen süßsauer im Shan-Shan in der Gleimstraße. (Chinesisches Essen)
Interstellar, der beim zweiten Mal noch besser war. Tessa Blomstedt gibt nicht auf, mal wieder ein grandioser Marthaler. Quizoola von Forced Entertainment im Live Stream (und Das große Heft im HAU). Alles von Emmanuel Carrère, aber am besten war Un roman russe, das Buch, in dem einem der Autor zwischendurch wahnsinnig unsympathisch wird. Der erste Knausgard-Band, der Rest kommt 2015. Dein Name von Navid Kermani, das hätte ich den begeisterten Freunden ja auch schon mal früher glauben können. Die vielen Stunden im Metropolitan Museum. Ich bin das Glück dieser Erde von Julián Hernández, Dank an Lukas, der das für den Podcast vorschlug. Überhaupt der Podcast: meist ein großes Vergnügen, selbst wenn ich dafür Mommy bis zum Ende durchleiden muss. Viele tolle Serien, von denen ich die bei weitem nicht beste, nämlich Damages, am Stück weg mit dem vielleicht größten Vergnügen sah. (Es gibt manchmal doch sowas wie guilty pleasures.) In der Vorfreude/Begeisterung-Ratio dagegen am untersten Ende: der neue Godard. (Filme, Bücher etc.)
Und ja, okay, das Brasilienspiel. (Das Gehirn gibt auf)
Florian Krautkrämer
Im Sommer war Rabih Mroué bei uns an der HBK in Braunschweig zu Gast, um seine Performance-Lectures vorzustellen. Er hatte einen früheren Zug genommen, so dass wir noch ein wenig Zeit hatten, bevor die Veranstaltung begann. Ich fuhr ihn mit dem Auto ein bisschen durch die Stadt, so wie er es mit Catherine Deneuve 2008 in «Je veux voir» getan hatte. Nun ist Braunschweig natürlich nicht Beirut, hier geht es nicht um sichtbare Wunden, sondern um das Versteckte, beispielsweise das ehemalige Zwangsarbeiterlager mitten im Wohngebiet, auf dem jährlich das Schützenfest stattfindet. Oder den Reichsadler außen am Versammlungsgebäude, so mit Steinen zugemauert, dass seine exakte Form erhalten geblieben ist. Das Unsichtbare ist auch Thema bei Mroués Lectures. In der anschließenden Diskussion fragte ihn eine Studentin, wie er seine Ideen bekomme, bspw. zu der Auseinandersetzung mit dem Tape eines Selbstmordattentäters in «Three posters». Mroué antwortete, dass die Ideen nicht vom Himmel fielen. Sie entstünden aus der permanenten, fast obsessiven Beschäftigung mit den Dingen. Dass er dieses Tape gefunden hat, war reiner Zufall; dass er die Dinge darin gesehen hat, die er anschließend herausarbeitete, nicht. Um das Unsichtbare zu sehen, muss man die Augen offen halten.
Jan Künemund
Mein algorithmisch errechnetes Jahr bei Facebook sieht ziemlich armselig aus, ich könnte das da nicht veröffentlichen. Die Strategie, auf plötzliche Aufreger erstmal mit Nachdenken zu reagieren, ist nicht aufgegangen, weil mir regelmäßig Kommentarthreads davonrannten, so dass man bei mir keine Aktivitäten feststellen konnte und sich dadurch kein 2014er Material gebildet hat. Allenfalls ein Bild taucht da auf, ein Kind mit Zigarre, schnell gegen die traurige Erkenntnis gesetzt: es wird 2014 und auch danach keinen Film von Peter Liechti mehr geben. Konnte man Peter Liechti auf Facebook kondolieren? (wie z.B. Brian Claflin in diesem Jahr, dem früh verrauschten Erfinder queerer Undergroundpartys, dessen Eltern sich im gleichen Kommentarthread schließlich für die Erkenntnis bedankten, ihr Sohn hätte in Berlin viele Freunde gehabt.) Der Tod ist ein alter Aufreger.
Alte Aufreger und neue Medien konnte ich nicht mehr so gut als inadäquate Verbindung belächeln, seit 17.500 Rassisten über Facebook mal schnell aus den mutmaßlich mit Weihnachtsdekoration verkleideten Wohnzimmern auf die Straße gelockt werden konnten. Offene Homophobie plötzlich, Anti-Intellektualismus des Steuerzahlers, eine Suhrkamp-Autorin, die das vom lesbischen Kinderwunsch ersehnte Ergebnis einer In-Vitro-Fertilisation als «halb Mensch, halb Weißnichtwas» bezeichnet, irgendwie sind mindestens 50 Jahre Kulturwissenschaften für die Katz gewesen, auch wenn mir in diesem Jahr 28 Studierende gegenüber sitzen und Begriffe wie «Heteronormativität» so selbstverständlich verwenden wie Marmelade. Ist das immer noch altes Denken gegen neues Denken (Gender/Wahnsinn)? Oder Denken gegen selbstbewusstes Nicht-Denken, das aber als Aktivität messbar wird?
Neue Strategien in alten Medien gab’s wenig in meinem 2014. Auch wenn eine Serie wie Transparent sich geradezu einen Witz daraus macht, den Algorithmus einer «Fernsehfamilie» zu sabotieren, steht da am Ende (bzw. Anfang 2015) doch die Turing-Maschine, die ein Biopic schön reproduktiv auf einen Überblick-Sieg hin entwirft, und ein wie beiläufig in Lebensgeschichten wandernder Film wie Boyhood, dessen Ende doch von Anfang an geschrieben war, von den ganzen Aufregerfilmen, die ihren Abreger gleich mitverkauften, ganz zu schweigen, Monsieur Claude, Maman und ich, 12 Years a Slave, altes Programmkino-Kinoprogramm für alte Facebook-User, von dem ich mich nach Restglückmomenten bei Suzanne, W imię... oder Exhibition wohl endgültig verabschieden werde. Doch schon integriere ich vermeintlich Sinnloses selbst auf einer Zeitlinie, organisiere ich vom Ende her, was eigentlich alles neben- und übereinander steht, genauso, wie ich neben Transparent ja auch 4 Staffeln heteronormatives Parenthood gesehen habe dieses Jahr, so ergibt der Abschluss keinen Sinn.
Dazu passend vielleicht ein Moment, in Cannes, 9-Uhr-Wiederholungsscreening von Bonellos Saint Laurent, dem nichtreproduktiven von den beiden Biopics, das es bisher nicht ins deutsche Programmkino geschafft hat. Ein junger Onlinejournalist aus Paris, müde von zu vielen Filmen, zu vielen Partys, zu viel Aufregung in alten Medien, schläft enthusiastisch neben mir ein und verpasst das, was ich als Staffelung diverser Glücksmomente in Erinnerung habe, deren Organisation ich mir nicht erklären konnte: Helmut Bergers Stimme plötzlich, Helmut Bergers Hände plötzlich, und dann noch ein Bild und noch eine Musik und eine weitere Drehbewegung um eine Figur herum im immer breiter angelagerten Material, Maria Callas natürlich, warum auch nicht. Es hört nicht auf, ich staune, der Journalist neben mir atmet dazu gleichmäßig. Als das Saallicht angeht, fragt er mich: «Wie war das Ende?» Ich kann nur antworten: «Welches?»
Christine Lang
2014 habe ich weiterhin einige Zeit mit Fernsehserien verbracht: Am Anfang des Jahres noch einmal intensiv mit mit Breaking Bad (das gar nicht dramaturgisch so geschlossen erzählte Finale) und Mad Men (als Analyse von Geschlechterverhältnissen) auseinandergesetzt. Zu den wichtigen (Wieder-)Entdeckungen des Jahres zählte für mich die Fernsehserie I Love Lucy aus den 1950ern von Lucille Ball mit hoher medialer Selbstreflexivität und ihrem großen Spaß machenden anarchisch feministischen Potential. Mitte des Jahres dann True Detective gesehen, mit Begeisterung bis zu der beeindruckenden Steadicam-Choreografie in der vierten Folge; von den dann folgenden Drehbuchideen, unter anderem die Frauenrollen betreffend, aber so enttäuscht, dass sich meine Meinung über die Serie nicht mehr ganz erholen mag. Ende des Jahres von der Serie Fargo angetan, vor allem dem ja nicht einfachen aber gelungenen Versuch Billy Bob Thorntons, der Auftragskiller-Filmgeschichte eine originelle abgründig-charmante Variante hinzuzufügen.
Vor allem aber ab Mitte 2014 Harun Farocki und den Austausch mit ihm vermisst. Seine Installation Parallele I-IV im HKW beim Documentary Forum wird nun also das letzte Werk seiner immer an der Gegenwart arbeitenden Videokunst sein. Vor allem haben mich Parallele III und IV, in denen die Handlungsmacht bzw. -ohnmacht der Avatare und Spielfiguren thematisiert wird, beschäftigt und angeregt, darüber nachzudenken, inwiefern sich das in unserer fiktional-narrativen Kultur ideologisch dominante tragödische Motiv vom Film in Computerspiele übertragen hat: Das Subjekt kann sich (sich frei auf Brecht beziehend) nach der Decke strecken, es kann aber nicht die Decke selbst strecken… Harun Farockis Arbeit zielte immer darauf, die Begriffe mittels der durch sie bezeichneten Dinge selbst zu befragen, um auf diese Art hinter diese zu gelangen. Vielleicht ist diese, seine Haltung das Wichtigste, was ich persönlich aus 2014 mit in die nun leider Harun-Farocki-lose Zukunft nehme.
Franz Müller
Habe bei Unknown Pleasures an einem der ersten Januartage 2014 Nebraska (alter Mann mit seinem erwachsenen Sohn unterwegs) gesehen und am nächsten Tag meinen Vater angerufen, ob er nicht 2014 mit mir für eine Woche nach Irland fahren will. Oder woanders hin. Nach Holland ins Kröller-Müller Museum, wo die Van Gogh Bilder hängen, die Jean-François Millet nachempfunden sind und bei denen man förmlich die Erde riechen kann, oder nach Brüssel. Ja, hat er gesagt. Dann ging es nicht, weil er am Kiefer operiert wurde, und dann ging es bei mir nicht wegen der Filmerei, und jetzt ist das Jahr zu Ende. Ich fürchte, es wird nicht mehr passieren. Vielleicht ist es auch besser so. Im Kino sieht so eine Reise dann doch immer besser aus.
Mittagessen in der Josef-Roth-Diele. Dieser seltsam auf alt getrimmte Ort, an dem eigentlich alles falsch gemacht wurde und der mir trotzdem so sympathisch ist. (Ich bilde mir ein, dass das nicht daran liegt, dass der Namensgeber für ein paar Monate mit der von mir geliebten Autorin Irmgard Keun zusammen war.)
Die Erinnerung daran, dass Low Budget Filme machen ein Segen sein kann. Weil man Leute bitten muss, einem schöne Dinge für wenig oder gar kein Geld zu überlassen. Weil man diese Leute deshalb persönlich fragen muss.
Das zweistündige Telefonat mit Wolfgang Michels, der den tollen Rio Reiser Song «Ich bin müde» geschrieben hat und der von 1969 bis 1974 mit einer Band namens Percewood’s Onagram Musik gemacht hat. In Bremen.
Rock’nRoll. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gab in Deutschland. Nicht damals und auch nicht danach. «Home To You» und «Drive Me Somewhere». Songs, wie aus dem Soundtrack eines Lemke Films von 71. Irgendwas zwischen Van Morrison und den Stones. «Religion and Love»: düster, gerade, ganz einfacher Sound. Ich musste unwillkürlich an die Gemeindesaaldisco in Èdouard Luntz’ schönem Film Les coeurs verts denken.
Alle vier Platten von Percewood’s OnAGram gibt es seit 2003 auch auf CD.
Der Mailwechsel mit Howard Eynon, ein Freund meines Sohnes, der so eine Art australischer Sixto Rodriguez ist, allerdings eher an Cat Stevens erinnert als an Bob Dylan. Ein immer noch Hippie, dessen Song „Happy“ immer noch froh macht. Sein einziges Album von 1974 ist 2014 neu verlegt worden. Bei Fire Records: so what if im standing in apricot jam.
Cristina Nord
In der Rückschau kommt es mir vor, als hätte ich 2014 besonders viele beeindruckende Filme gesehen. Lav Diaz’ Mula sa Kung Ano ang Noon (From What Is Before), Lisandro Alonsos Jauja, Tsai Ming-liangs Xi You (Journey to the West), Thomas Heises Städtebewohner, Wes Andersons The Grand Budapest Hotel, Sergei Loznitsas Maidan, Frederick Wisemans National Gallery, Ruth Beckermanns Those Who Go Those Who Stay sind nur einige, dazu die Miniserien P'tit Quinquin von Bruno Dumont und Olive Kitteridge von Lisa Cholodenko. Vielleicht ein Trugschluss, aber auch ein gutes Argument gegen Kulturpessimismus, Bitternis und Abgesänge.
Im Juli wandere ich acht Tage lang durch die Berge über dem Osttiroler Virgental. Regressive Reime beim Überqueren von Schneefeldern, Kissenschlacht im Hüttenlager, Schneehühner unter einem Felsvorsprung, Bad in einem See, in dem noch Eisschollen treiben. Möchte keine Minute missen.
An einem regnerischen, windigen, kalten Dezembertag in New York besuche ich eine kleine Schau von Jean Dubuffet im MoMA. Dubuffets Arbeiten haben mich schon als Teenager, bei meinen ersten Reisen nach Paris, fasziniert, und jetzt ist die Begeisterung von damals sofort wieder da, besonders beim U-Bahn-Bilderbuch «La Métromanie ou les dessous de la capitale» und bei «Barbes des retours incertains». Der Bart wird übermächtig, schiebt das Gesicht an den Rand, ein einziges Gewimmel, das potenziell die ganze Welt enthält.
Michaela Ott
Der fortgesetzte Versuch, Kunstproduktionen aus afrikanischen Ländern zu verstehen, für die sich wissenschaftlich hier kaum jemand interessiert, warum eigentlich, wieso nicht? Mit Kracauer sind sie zumindest symptomatisch von Interesse, trotz ihrer oft unzulänglichen ästhetischen Suchbewegung, schon aufgrund der mit ihnen verbundenen Politiken: Dak'art in Dakar, Journées cinématographiques de Carthage in Tunis, Afrikamera in Berlin samt Veranstaltungen zum 20jährigen Ende der Apartheid oder zu 130-Jahre-Kongokonferenz. Verlängerte Anstrengungen, über das «Andere» zu berichten, das sich im besten Fall als das «Eigene» entpuppt: Bedeutsam die Einsicht in Martin Baers Dokumenarfilm Weiße Geister (2004), dass die deutschen «Schutztruppler» in Deutsch-Südwestafrika nicht nur den ersten, bis heute nicht eingestandenen Völkermord des 20. Jahrhunderts (1904-1907) begangen, sondern jede Menge Nachkommen mit Hereros gezeugt haben. Bedenkenswert dazu Jean-Marie Tenos Mutmaßung in Le Malentendu Colonial (2004), dass die Probe auf den Holocaust bereits dort vollzogen worden ist. Immerhin beeindruckend die Kraftanstrengung bei dem jeweiligen Event, mit Kunstproduktionen die globale Geringwahrnehmung des afrikanischen Landes zu durchstoßen und demokratische Strukturen in der Stadtlandschaft und auf dem Kontinent zu befördern, von den Rändern her: Dakar, Tunis, Kapstadt usf.
Die besondersten Filmbilder und -töne des Jahres, nicht zeitgenössisch, vorgeführt im Berliner Arsenal: Antonio Reis' und Margarida Cordeiros Spielfilm Ana (1982), der mit einem Schlag sichtbar und hörbar macht, woher Pedro Costa seine Filmsprache bezieht: Dieselbe geduldige Ausleuchtung von Innenräumen, dieselben Alltagstexte in bedächtig-singender Intonation, in berauschend eigenwilligen Bildern, freilich vielfarbiger und leuchtender als in Costas Dunkelreich.
Ansonsten der Eindruck wachsender Düsternis, je weiter östlich der Spielfilm angesiedelt ist: Wo sogar die Gebrüder Dardenne dem ökonomischen Verlustspiel von Zwei Tage, eine Nacht (2014) noch einen minimalen symbolischen Gewinn abluchsen oder die griechische Finanzpsychomisere noch in lichten Bildern wie bei At home (2014) von Athanasios Karanikolas daherkommt, lassen der russische Leviathan (2013) von Adrej Zvyagintsev, eine moderne Hiobsgeschichte, die chinesischen Gewaltkaskaden in A Touch of Sin von Tian Tsu Ding oder das kasachische Auszehrungsdrama Nagima (2013) von Zhanna Issabayeva kein Quentchen Wohlleben, kein Quentchen Anteilnahme, allenfalls Fortdauer des Unerträglichen bestehen. Im türkischen Film Kumun Tadı von Melisa Önel erzählen nurmehr schwankende Lichtflecken von migrantischen Dunkelexistenzen; und auch der türkische Cannes-Gewinner Winterschlaf von Juri Bilge Ceylan braucht viele Worte, um sich über die anatolische Sinnleere zu retten. Als Erlösung erscheint, wenn der Protagonist von Sunny Days (2011) des Kasachen Nariman Turebayev endlich umkommen darf. Nicht geboren zu sein präsentiert dieser zeitgenössische Film als die bessere Wahl. Der Drang nach Selbsterhalt hat hier längst dem (Selbst)Vernichtungsaffekt Platz gemacht.
Peter Praschl
Im Sommer für eine Frauenzeitschrift zusammen in Ystad Karl Ove Knausgård interviewt. Ein Ort, der mich an Westerland erinnerte, Sommertourismusödland, wir saßen im Hof eines Omacafés, schiefe Tische, wahnsinnige Hitze, keine Sonnenschirme, Knausgård machte das nichts aus, er trug abgeschnittene Jeans und ein Sommerhemd, wir Interview-Outfits. Wie oft bei Interviews war das, was nicht erschien, für mich sehr viel interessanter als der Text, der schließlich in der Zeitschrift stand (immer noch die Sehnsucht nach einem Heft, in der Interviews wieder genau so sind wie in den frühen Ausgaben von Warhols Interview; macht niemand mehr...). Knausgårds Schilderungen über die Entstehung von Mein Kampf, das automatische Schreiben, zu dem er sich gezwungen hatte, fast keine Überarbeitungen, zuerst 10, schließlich 20 Seiten täglich. Das Verrückteste: Es gab einen Freund, dem er JEDEN TAG vorlas, was er geschrieben hatte. Sofort gedacht: DAS ist die Geschichte, die man noch erzählen müsste: die Geschichte des Mannes, der Anrufe seines Freundes Knausgård bekommt, in denen es um den Alkoholismus dessen Vaters, Kindheitsdemütigungen durch Blümchenbadekappen und ähnliches geht, während er für den Abend noch etwas vorhat, Kinder mit ihm spielen wollen usw. – Während er uns zum Bahnhof begleitete, im Gehen Abchecken meines literarischen Geschmackes als Österreicher, ob ich denn Bernhard gern hätte, ich sagte, nein, nie, ging mir immer auf die Nerven, als Österreicher, wissen Sie, praktisch jeder Hausmeister schimpft genau so. Aber Ihren Landsmann Peter Handke werden Sie doch mögen...? Ja, sagte ich, ja. (Und die ganze Zeit über mein Groll, dass er, Knausgård, das Buch bzw. die sechs Bücher geschrieben hatte, die eigentlich ich hatte schreiben wollen; [wollte erst warten, bis bestimmte Leute tot sind]; jetzt geht das nicht mehr; aber das konnte ich ihm nicht sagen..., meines allerdings wäre nicht so männermäßig gewesen....)
*
Buch: Rebecca Solnit, The Encyclopedia of Trouble and Spaciousness. Lesen Sie Solnit, Sie werden sie mögen, glaube ich.
*
Fernsehen: Die Liveübertragung der Ansprache Wladimir Putins zur Annexion der Krim.
*
Musik: D'Angelos Black Messiah. Nach 14 Jahren. Und jedes einzelne davon war ich ungeduldig.
*
Film: Kennt Ihr Euch alle viel besser aus als ich, ich komm nicht mehr dazu, ich geh kaum noch raus, ich kann das Kind nicht loslassen, ich liege neben ihm und höre ihm beim Einschlafen zu, und erzähle ihm Geschichten und höre mir seine Geschichten an.
*
Im Herbst für die "Welt" mit Patti Smith über Haruki Murakami gesprochen. Seit mehr als 30 Jahren nicht so nervös gewesen vor einem Interview (damals, mein allererstes, der Versuch eines Telefoninterviews mit Handke, er legte gleich wieder auf). Denn, Patti Smith, du hast mir das Leben gerettet, als ich 17 war, don't fuck much with the past, but fuck plenty with the future. Es war dann aber ganz entspannt. Und wie oft bei Interviews war das, was nicht erschien, für mich sehr viel interessanter als der Text, der schließlich in der Zeitung stand: Du musst endlich schreiben, was du schreiben willst, sagte Patti Smith, scheiß auf die Angst, vergiss den Selbsthass, gib mir deine Hand, versprich es mir, 2015 wirst du damit beginnen. Es fühlte sich an, als wollte sie mir das Leben retten.
Bert Rebhandl
Im Oktober bin ich für ein paar Tage in Kyiv. Eines Abends gehe ich in die Oper. Ich möchte wissen, wie sich das anfühlt, eine Vorstellung in der Nationalen Oper der Ukraine. Vor der Kasse spricht mich ein Mann an: Er kann mir eine gute Karte besorgen, dreißig Prozent unter dem regulären Preis. Ich lasse mich darauf ein, weil ich wissen will, wie die Sache weitergeht. Er bringt mich zum Eingang, der Türsteher übernimmt, die Verkäuferin der Programmhefte bringt mich zu einem Logenplatz. Die Person an der Kasse muss auch eingeweiht gewesen sein, denn anders war ja nicht zu gewährleisten, dass nicht doch jemand meinen Platz reklamieren würde. Ein kleines Beispiel dafür, wie Geld den regulären Kreisläufen entzogen wird. Ist das schon Korruption? Der Aufstand auf dem Maidan hatte eine Parole (jedenfalls, wenn ich Sergej Loznitzas Film darüber folge): Weg mit dem Pack. Das Pack, das war vor allem die Janukowitsch-Entourage, die das Land systematisch enteignet hat. Das Ergebnis des Aufstandes ist, dass die Ukraine jetzt durch den IWF in Kredithaft genommen wird, um Schulden zu bezahlen, deren Gegenwert längst auf Geheimkonten liegt. Die Aktivisten des Maidan, zu denen auch junge Leute von Dovshenko Institut gehören, mit denen ich lange spreche, mögen Losnitzas Film nicht. Sie sind unbeirrt der Meinung, der Regierung die Bedingungen für eine gerechtere, offenere Gesellschaft diktieren zu können. Österreich, das Land, als dessen Bürger ich durch meinen Reisepass ausgewiesen bin, hat Putin in diesem Jahr den roten Teppich ausgerollt. Ich habe ich geschämt.
Nach der Pressevorführung von Christian Petzolds Phoenix sitzen wir in einem Cafe. Eine Männerrunde. Wir tauschen Argumente aus, Möglichkeiten, sich zu diesem Film zu verhalten. Ich bin beeindruckt, war aber beim Sehen nicht konzentriert genug, um die Konstruktion mit Sicherheit als gelungen betrachten zu können. Vier Tage später, nach einer ungleich trivialeren Pressevorführung, erreicht uns die Nachricht von Harun Farockis Tod. Ein paar Wochen später bin ich in Toronto, sehe dort Phoenix zum zweiten Mal, in der offiziellen Weltpremiere. Nun geht alles auf, ich sehe jedes Detail, begreife den Wagemut und die Klugheit der Konstruktion – ein Mann, der mit Blindheit geschlagen ist, eine Frau, die sich nicht auf eine Opferrolle festlegen lassen will, davor aber in Wiederholungszwänge flüchtet. Dass ein Film sich so deutlich als Konstruktion ausweist, leuchtet vielen nicht ein (es erscheinen auch ein paar richtig peinliche Texte zu Phoenix), mich aber überzeugt gerade das: Intelligenz, Form, Erzählung.
Im November bin ich in Wien, um ein Gespräch mit Jacques Rancière zu moderieren. Während ich mich darauf vorbereite, wird mir wieder klar, warum ich mit seinen Texten so viel mehr anfangen kann als mit denen vieler anderer (Mode-)Philosophen. Es hat damit zu tun, dass er eher Operationen anbietet als Aussagen. Ich lese Rancière ein wenig wie Luhmann, mir kommt auch vor, dass ihr jeweiliges zentrales Manöver recht ähnlich ist, wenngleich mit einem gegensätzlichen Interesse. Beide Interessen kann ich teilen. Das Gespräch findet im Österreichischen Filmmuseum statt, dessen Direktor Alexander Horwath einer meiner besten Freunde ist, und der meinen Blick auf das Kino vor allem in den neunziger Jahren, als ich noch in Wien lebte, geprägt hat wie niemand anderer. Seine Freude über den gelungenen Abend teile ich auch.
Manfred Rebhandl
* Auch ich habe ein Häuschen am Land, in Oberösterreich. Im Frühling bestellte ich die Scholle, allerlei Zeugs kam beim Umgraben zum Vorschein: Ziegel, Drahtgewirr, Autoreifen, eine Kühlschranktür. Mein Vater hatte das Häuschen hier in den 60er Jahren auf Sumpfgrund gebaut, und die Grünen wussten damals noch nicht einmal, dass es sie mal geben würde. Ich kaufte Bohnen von der Arche Noah, einer Samenbank, die gegen Gen-Mais ist und alte Sorten bewahrt, das Säckchen kostete 3,90. Bei Neumond brachte ich die Saat aus, in drei Reihen, dann schaute ich True Detective. Im Zweiwochenrhythmus besuchte ich meine Mutter in dem Häuschen, und schaute dabei nach meine Bohnen. «Du wächst ja wie der Schnittlauch!», sagen die Erwachsenen in dieser Gegend zu den Kindern, wenn sie diese länger nicht gesehen haben. Und die Kinder werden dann rot im Gesicht und schämen sich furchtbar für die peinlichen Erwachsenen. Meine Bohnen wuchsen sogar schneller als der Schnittlauch, im Juni waren sie mannshoch, im September dreimal so groß, aber sie schämten sich nicht, wenn ich ihre Fortschritte lobte. Mit dem Rechen musste ich die Bohnenstangen herunterbiegen, um die Früchte ernten zu können, es wurde ein halber Lastwagen voll, und ich war stolz wie ein Berliner, dem irgendwo in der Uckermark eine Tomate gewachsen ist. Nur dass ich bei der Ernte keine Umhängetasche trug und keinen Hipsterbart, weil Bart an meinen Backen noch langsamer wächst als Schnittlauch im Hochbeet.
* Letztes Jahr sprang meine damals 7jährige im örtlichen Freibad vom Dreimeterbrett, ich war ein stolzer Vater und beschrieb das als einen meiner Höhepunkte 2013. Heuer hatte sie die großartige Idee: «Papa, du musst auch springen!» Und sie untermauerte das «Muss» mit einem Vorwurf, den man nicht so gerne hört, schon gar nicht von der eigenen Brut: „Papa, du bist feig!“ Ich mit meiner Höhenangst klettere also hinauf, es war 12 Uhr mittags, die Sonne schien hell, das Bad war voll, das blaue Wasser unter mir bereit für mich. Dann machte ich die paar Schritte nach vor in die Todeszone, sprach ein Gebet Richtung Himmel, und Platsch. Das dazugehörige Polaroid fertige meine Schwester, kurz zu Besuch aus Kalifornien, an, und verkaufte es später an die Tate. Dort hängt es nun neben dem Hockney und trägt den Titel: An even much bigger splash. Oder auf Deutsch: Weißbrot fällt von Dreimeterbrett.
* Früher war er Korrespondent in New York, Rio de Janeiro und London. An diesem Tag kam er zu mir nach Wien, und schon wie er sich dem Caféhaus näherte, mit Rollköfferchen, weit offenem Trenchcoat über weißem Hemd, einer roten Marlboro im Mund, das hatte richtig Style. Matthias Matussek, Katholik und Edelfeder des deutschen Feuilletons, hatte irgendwie meine Krimis in die Hand gekriegt, und sie gefielen ihm so gut, dass er darüber eine Seite in der Literarischen Welt gestalten wollte. Der servile Kellner im Café Westend empfahl ihm Rostbraten mit allem, Matussek rauchte dazu Kette, trank Bier, und notierte in seinen Moleskines, was ich zu sagen hatte, während er mir erzählte, wie das bei ihm früher so lief, also wie er z.B. in Rio im Pool seines Korrespondentenhauses stand, eine Cohiba in der linken Hand, ein Glas Gesöff in der anderen, und die Spiegel-Sekretärin am Ohr, die ihn fragte, ob das Leben nicht gefährlich wäre in Rio, kicher kicher. Was für ein Leben der hatte! Wir verstanden uns auf Anhieb und lachten viel gemeinsam, und nachdem wir gerülpst und gefurzt hatten wie zwei richtige Protestanten, wanderten wir durch das Ottakring meiner Krimis und kamen dabei auch zum Weltspiegel-Kino, einem alten Pornoschuppen, der in meinen Büchern Dirty Willis Swedish Pornhouse heißt. Matusseks Lächeln dehnte sich bis zu seinen Ohrwascheln, er geht ja im Vatikan ein und aus und ist von dort her einiges gewöhnt, aber das hier gefiel ihm auch. An der Wand klebte ein Zettel: «Heute Gangbang mit Amanda, 20 Uhr.» Das Pornokino, das früher noch Zelluloid abspulte, diversifizierte nämlich gerade in Richtung Swingerclub. Ich konnte sehen, wie Matussek ganz leicht auf und ab hüpfte vor Freude, wir überlegten, was wir bis 20 Uhr machen sollten. Ich rettete den Katholiken, indem ich ihn zu Sue Widl ins Café Korb schleppte, Sue ist die Frau von Peter Weibel, ein echtes Vollweibel mit Brüsten wie Melonen und einem Herz, groß wie das Riesenrad. Als sie Matussek sah, wollte sie ihn haben, denn Weibel ist ja ständig in Karlsruhe. Sie zog ihn an sich und drückte ihm einen Kuss auf den Mund, dann gab´s Gulasch mit Apfelstrudel. Wenn Matussek nun Interviews macht, dann erzählt er von Wien und nicht mehr von Rio.
Cord Riechelmann
Wenn es um Theorie und Philosophie geht, kommt das Schöne immer noch zuerst aus Frankreich. So geschah es im späten Sommer, dass in der Sendung Contre-Courant unter der Moderation der Philosophin Aude Lancelin Thomas Piketty und Alain Badiou über das Kapital, Marx und Revolution oder Reformation diskutierten bzw. einfach sprachen und Argumente austauschten. Das war so schön, dass selbst Piketty irgendwann immer wieder nickte, wenn Badiou sprach. Es redeten hier drei Menschen miteinander, die wussten, wovon sie sprachen. Ungleichheit ist für sie keine Kleinigkeit, sondern ein Übel grundsätzlicher Art und gerade deshalb nicht hinzunehmen. Und um der Schönheit noch eine Art Krone aufzusetzen, meinte Badiou ziemlich am Anfang des Gesprächs, dass es doch eine Tatsache sei, dass Piketty, er selbst und Marx «heterodoxe Marxisten» seien. «Heterodoxe Marxisten» – das ist mindestens der Begriff des vergangenen Jahres und gleichzeitig auch die Erklärung, warum die Wirtschaftsredaktionen der Qualitätszeitungen Piketty mit dummen Kommentaren verfolgen. Die Zeitungskrise ist keine bloße Anzeigenkrise, sie ist auch die Pisakrise des verschwundenen Bildungsbürgertums.
«Das Bürgertum bildet kein Subjekt mehr, es ist nur noch ein Ort», hat Alain Badiou dazu bereits 1982 in seiner Theorie des Subjekts geschrieben. Das Buch, im Herbst erstmals auf Deutsch bei Diaphanes erschienen, ist auch deshalb so wenig alt, weil darin der ehemalige Ostblock schon nur noch als Psychiatrie vorkommt, als schon sehr tot, als Veranstaltung, die sich mit der Opposition nur auseinandersetzt, indem sie sie der Psychopharmakologie überstellt. Von heute aus gesehen, erklärt es die immer noch kaum fassbare Überlegenheit des französischen Denkens vom Ende der 1970er über die ganzen 80er Jahre hinweg ziemlich gut: Auf eine diffuse Art rechneten Foucault, Deleuze, Lyotard und Badiou als der Jüngere in ihrem Denken schon nicht mehr mit dem real existierenden Ostblock. Den hatten sie schon abgeschafft gesehen und dachten in den dadurch eben nicht leer gewordenen Raum ihre Erzählungen vom verschwindenden Menschen. Klarer als der Rest der Welt sahen sie, dass es für ein materialistisches Denken nicht mehr ausreicht, erst Gott und dann den Menschen abzuschaffen. Da musste was grundsätzlich anderes, vielleicht Neues gedacht werden, das Lyotard als «das Inhumane» benannte und Guattari unter dem Titel Die drei Ökologien zu fassen suchte. Und Badiou unter der Formel eines «Idealismus ohne Idealismus», der den Materialismus vor seinen vulgären Zügen im Kampf gegen Gott und den Menschen nur retten kann, wenn er die Logiken der Welten gegen die eine, bloß eingebildete Welt endlich erkennt.
Dazu passte irgendwie auch der würdigste Moment auf den vielen Beerdigungen des Jahres: Der Elektroexperimentalpionier Frieder Butzmann war auf der Trauerfeier von Alex Kögler in der Kapelle eines Friedhofs am Südstern in Berlin-Kreuzberg aufgesprungen und hatte während seiner Spontanimprovisation mit der Hand auf den Sarg geschlagen und gerufen: Mensch, Alex Kögler, ich kann gar nicht glauben, dass du jetzt da drin liegst. In einer Art Bayern-Joppe gekleidet hatte Butzmann dann mit einer Geste den ganzen Alex Kögler (1958-2014) als Körperbewegung wachgerufen und damit ein Monument der Präsenz beschrieben. Alex Kögler hatte Anfang der 80er Jahre gleich neben den Yorckbrücken das Nachtlokal «Risiko» betrieben, einen der Orte einer immer noch zu schreibenden Topologie der 80er Jahre. Oscar Roehlers Film zum «Risiko» kommt dieses Jahr ins Kino und egal wie er wird, notwendig ist er unbedingt.
Das Kinojahr begann mit James Grays Metamelo The Immigrant und The Wolf of Wall Street, also ziemlich gut. Auf der Berlinale vor allem George Bancroft in Sternbergs Wirtshausschlägereifilm The Docks of New York (1928). Wogende Körper, musikalisierte Kollektivbewegungen wie in Brittens Billy Budd, herausragende Inszenierung an der Deutschen Oper, gesehen im Frühjahr. Dann war wohl schon Sommer und als Kroos Ramirez gegenpresst, steht es nach 26 Minuten Nullzuvier und im Haliflor herrscht für einen Moment verstörtes Schweigen, als sei man Zeuge eines Verkehrsunfalls, live und unfassbar aus dem Maracana. Bei Tor Nummer fünf murmelt hinter mir jemand, Scheiße, schon wieder Deutschland und seit dem Maidan kann man nur froh darüber sein, dass die Austeritätsnationalistin Merkel und kein sozialdemokratischer Einflusszonenversteher in Exportweltmeisterumkleidekabinen Public Relations betreiben darf. Trotz beängstigend proliferierendem Großmachtrenaissancedenken (wie gehabt: bevorzugt in der antiamerikanischen Maskerade deutscher Geschichtsvergessenheit, beispielhaft auch die Mark Zuckerberg-«Karikatur» in der SZ vom 21.02.2014) sehr gelacht über die peinliche Blechtrommel Volker Schlöndorff, der in George Packers Merkel-Porträt für den New Yorker neben den kurzsichtigsten Politikjournalisten des Landes als Insider/Stichwortgeber auftritt und kanzlerpsychologische Deutungen auf der Basis von Potsdamer Grillpartyabenden souffliert. Kurz vor Jahresschluss dann zum Ausgleich noch geistig arme Bratwürste der nichtstaatstragenden Art, made in USA: Dumm und Dümmehr von den eigentlich schon abgeschriebenen Farrellys nachgeholt. Erhaben in jeder Hinsicht. Satz des Jahres deshalb fraglos: «But it’s still uncanny».
Armin Schäfer
Jean-Luc Godard, Adieu au langage. Weil meine Augen und Ohren im Lauf der Zeit verschleißen, werden an mir gelegentlich Untersuchungen durchgeführt, die Auskunft über den Stand des Verfalls geben sollen. Adieu au langage wirkte wie ein mir unbekannter neurologischer Test. Je weiter die Einschränkung meiner Wahrnehmung fortschreitet, desto mächtiger ist ihre Programmierung: Mein Sehen und Hören bestehen aus lauter Gewohnheiten, die ich selbst nicht bewusst bemerke. Wenn sie aber nach und nach ins Bewusstsein aufsteigen, wird frei gesetzt, was sie einschließen: Links und rechts, oben und unten, Nähe und Ferne sind zuallererst psychische Zustände, in denen alt eingeübte Sitzordnungen, einst bewohnte Zimmer, ganze Landschaften anwesend sind.
Jonathan Glazer, Under the Skin. Der Vers „Ich fühle Luft von anderem Planeten“ stellt eine neue Musik in Aussicht. Wenn ich sie höre, überlagern sich zwei Gefühle: mein Gefühl für etwas, das mir neu ist, und mein Zustand, der zwar fühlbar ist, aber mir kaum hilft zu begreifen, was ich höre. Vielleicht ist die Filmmusik von Under the Skin, die von Mica Levi stammt, solch eine Musik, die etwas Neues empfinden lässt, wenn auch kaum auszumachen ist, was überhaupt zu hören ist. Es scheint, als ob ein Gehechel von Hunden dem Zirpen von Transistoren sein Echo gibt und die Brandung des Meeres auf das Geräusch von Motorrädern antwortet, und trotzdem ist unklar, welche Klänge das weiße Rauschen maskiert, in dem der Film endet. Zurück ist mir eine Intensität der Empfindung geblieben, die nicht aus ihren Baustücken zu verstehen ist.
Schließlich ein Film von Johan van der Keuken, der mehr als zwanzig Jahre alt ist und den ich in diesem Jahr erneut gesehen habe. Van der Keuken ist in ehemalige Kolonien gereist, um das Nachleben der Militärmusik zu filmen: In Nepal, Suriname, Indonesien und Ghana hat er Ensembles aufgenommen, die auf Blasinstrumenten spielen. Er hat seinem Film Bewogen koper (1993) den englischen Titel Brass Unbound gegeben. Der niederländische Titel bezeichnet, was zu sehen und zu hören ist: Kupfer in Bewegung; der englische, was nicht: eine freie Blechbläsermusik. Das Militär hat Musikinstrumente, die Signale geben, stets geschätzt: Pauken und Trompeten sind leicht zu bedienen und weithin zu hören. Als das Militär in die Kolonien einzog, spielten Pauken und Trompeten. Und als die Kolonien ihre staatliche Unabhängigkeit errungen hatten, skandierte die Militärmusik auch die Aufmärsche und Zapfenstreiche der neuen Machthaber. Van der Keuken gibt der Musik keine zusätzliche moralische Botschaft mit, sondern zeigt, wie aus dem Blech die Instrumente gefertigt werden, wie die Spieler marschieren, wie die Musik an Riten und Festen teilhat. Und vor allem geht es um die allgemeinste Spielregel: den Gig, die Mucke, Musik gegen Geld.
Dominique Silvestri
Mit Holger Schulze die Goncourts lesen. Lesen als Prozess, das Protokoll ohne Raender, ohne Pointe.
Eines Abends in einer Spaetvorstellung Jodorowskis El topo gesehen, in einer ausgeblichenen Zelluloidfassung. Das Ineinanderverschraenken von Bildern, sie sich kurzschliessen, sie auseinandergleiten zu sehen, das ist, in loser Anlehnung an die Blumenberg-Lektuere dieses Jahres, fuer mich das Wiederaufleben von Bildern als Schrift gewesen, als Bewegungsform, als Text.
Gelegenheit gehabt, den von mir sehr gemochten Fotografen Koji Onaka kennenzulernen. Verlegenheit und Ratlosigkeit, ein Gespraech mit ihm zu beginnen. Ich fragte ihn nach der Provoke-Legende Takuma Nakahira, der, wohl nach einigen Drogenexzessen, zumindest zeitweise die Faehigkeit zu sprechen verloren habe und jetzt Bilder benutze, um sich Vokabeln und Gewissheiten zu verschaffen. Nakahira sei sehr, sehr krank, sagte nickend Onaka.
Touren auf dem Fahrrad, Meditation der Langen Dauer. Einen Unfall gehabt. Die Erinnerung einer Viertelstunde des Jahres 2014 fehlt mir.
Mir war bisweilen nicht klar, wofuer Text noch ausgeschrieben werden muesse. In Bildern Dinge unausgesprochen lassen koennen. Als ich auf einer Tour merkte, dass der eingelegte Film in der neuen Kamera nicht transportiert worden war, mithin keins der gemachten Fotos erhalten, daran gedacht, wieviel leichter man Bilder loeschen kann als Woerter, Saetze, Text. Einuebung in den Stoizismus des Verlusts.
Fabian Tietke
Filme: Kaguya-hime no Monogatari (Die Legende der Prinzessin Kaguya) J 2013, Isao Takahata. Ein vermutlich wirklich allerletztes Aufbäumen dieser Art von Animationsfilm im industriellen Kontext. Ab jetzt gibt es das endgültig nur noch im Independent-Animationsfilm (dem es in Deutschland weiter an einem Ort fehlt, der ihn mit dem Rest der Filmproduktion in Bezug setzt). Umso bewundernswerter sind dann Filme wie Signe Baumanes Rocks in my Pockets (USA 2014) – und umso schöner wenn die Mühen es dann wie hier wert waren. // Außerdem: Deborah Stratman In Order Not to Be Here (USA 2002), Sasha Pirker Closed Circuit (A 2013)
Wiederentdeckungen: Cinema ritrovato: Wild boys on the road (USA 1933, William Wellman), Riccardo Freda, Hitler's Reign of Terror (USA 1933, Cornelius Vanderbildt, Mike Mindlin). Letzterer ein unfassbarer Film, der hoffentlich bald wieder seinen Weg zurück findet in die Kinematheken wenn es um die Machtübertragung geht. Und natürlich: Kaagaz ke phool (Paper Flowers) (Indien 1959, Guru Dutt). Und: Johannes Beringers Das Zimmer (BRD 1966) und Situationen (BRD 1967), Philip Werner Saubers Der einsame Wanderer (BRD 1968).
Serien: The Hour (GB 2011-12, Idee: Abi Morgan) // Lu Zhen Chuan Qi (Female Prime Minister) (PRC 2013) // Three Kingdoms (PRC 2010) // Orphan Black (USA 2013-) // Wiederentdeckung: ReGenesis (CDN 2004-8) (unbedingt nach der 2. Staffel aufhören zu gucken).
Filmreihen: Die Margaret-Raspé-Filmreihe von Madeleine Bernstorff, Karola Gramann und Heide Schlüpmann. Durch die Reihe ist Raspé hoffentlich endlich wieder in Erinnerung gerufen. Außerdem sitzt man leider viel zu selten neben einem knatternden Super-8-Projektor im Arsenal. // Frederik Langs Robert Siodmak-Retro im Zeughauskino (allein schon die Wiederentdeckung der Tonfassung von Stürme der Leidenschaft (D 1932) ist ein kleines Wunder).
Lektüre: Das Heise-Buch von Matthias Dell und Simon Rothöhler hat mir den Ausklang des Jahres nochmal sehr verschönt. Jeden Abend einen weiteren tollen Text über Filme, die man dringend nochmal sehen müsste. // Ansonsten zwei Romane: Der Blick von Wu Ming auf die französische Revolution in L'armata dei sonnambuli und (mehr noch) James Norman (who?) unfassbarer, brillanter, gehirndurchrüttelnder «Krimi» (um die Krimihandlung gehts aber nur so naja) «Murder, chop, chop», der sich vielleicht knapp als internationalistischer Krimi eines ehemaligen Spanienkämpfers um einen mexikanischen Guerillero im chinesisch-japanischen Krieg beschreiben lässt, der bisweilen klingt als wäre er von George Herriman himself verfasst.
David Wagner
Mai
Die Fahrt nach Isfahan: Im Auto aus Teheran hinaus, durch die Wüste, über Berge, an verfallenen Karawansereien und einer unter Felsen versteckten Atomanlage vorbei. An einer Tankstelle steht ein Junge und möchte in Flaschen abgefülltes Blütenwasser verkaufen. In Isfahan ankommen und über den Meidān spazieren – das Morgenland ist doch ein Traum.
Juni
Ein Nachmittag in Potsdam, Stadion Luftschiffhafen (war mal ein Zeppelinlandeplatz, daher der Name). M. läuft die 800 Meter so schnell wie nie zuvor – und wird Berliner Meisterin. (Wie stolz Väter sein können, ich muß es allerdings verbergen)
Juli
Und dann die WM. Wie auch nicht. Die unglaubliche Freude nach dem Finale, im Haliflor, am 13. Juli. Die halbe Nacht sind wir draußen, Eberswalder/Ecke Schönhauser, auf der Kastanienallee. (Ein paar Jahre zuvor hatte M. mich gefragt, ob sie wohl je erleben würde, daß Deutschland Weltmeister wird. Schon geschehen. Schon passiert.)
Robert Weixlbaumer
Frühjahr, FU Berlin, Seminar neurokognitive Psychologie. Das Thema sind Normierungsfragen zu Filmclips für das Hervorrufen distinkter Emotionen (Gross & Levenson, 1995). Irgendwie hat sich Jordan Wolfsons doppelgeschlechtlicher Androide in das Referat mit Teresa hinein geschlichen, ein Clip aus der Galerie Zwirner: «My mother is dead», s/he says, softening you up. «My father is dead. I’m gay. I’d like to be a poet. This is my house.» Dazu wackelt er/sie mit den Hüften, unentschlüsselbar für die empirische Psychologie.
August-Praktikum in der Psychiatrie, Autobahn nach Dresden, Brandenburger Seenlandschaft, Depressionsstation. Am zweiten Tag das starke Gefühl, dass ich noch nie so weit weg vom Autorenleben war, wie hier, während es mir zugleich immer besser in diesem neuen Großbetrieb gefiel. Manchmal die Empfindung, forciert durch meinen reinen Beobachterstatus, in einem nie endenden Wiseman/Depardonfilm zu sein. Jeder Patient eine neue Geschichte.
Die drei Lieblingsanimationen: The Tale of Princess Kaguya (かぐや姫の物語); http://multimedia.mcb.harvard.edu; Is the Man Who Is Tall Happy? – Lebenskreis, Lernwahn, Chomsky/Gondry.
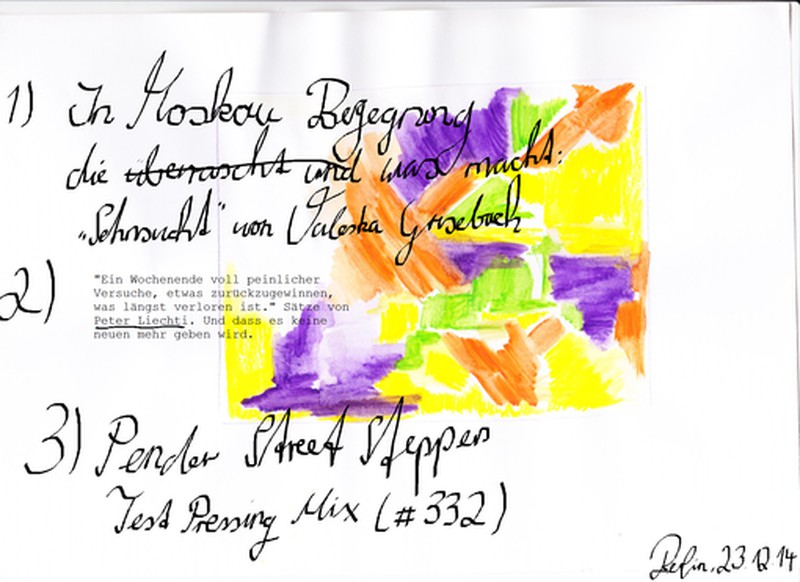
Matthias Wittmann
Pastis in Marseille (Bar Marengo, im August) | Liquore Strega an der Bar nach dem Screening von Clemens Klopfensteins Der Ruf der Sibylla (Stadtkino Basel, im November) | 24h-Livestream der Quizoola-Performance von Forced Entertainment (auch im November) | Nymph()maniac 1, The Wolf of Wall Street, 2 x Körperkino, 1x Geometrie, Mathematik und Fliegenfischen, 1x Slapstick, Hysterie und Farce, 2 Spielformen der Unersättlichkeit | noch ein Körperexperiment: Boyhood und die Erfahrung machen, dass Linklater immer noch genauso berührt wie mit Dazed and Confused vor (huch!) 21 Jahren | an Patti Smith in Berlin auf dem Weg zu Deux jours, une nuit (FSK) vorbeilaufen | nach dem Wahrnehmungslabor 3D (Stadtkino-Basel) mit 2D plötzlich nichts mehr anfangen können; zum Frühstück ein Interview mit JLGodard auf Youtube sehen, der mit herzerfrischendem Enthusiasmus davon schwärmt, im stereoskopischen D3D-Kino einen neuen Nullpunkt des Films gefunden zu haben («La technique est au tout début, comme un enfant, il n'y pas de règle!») | Ausstellungen: Le Corbeau et le Renard. Aufstand der Sprache mit Marcel Broodthaers (Museum für Gegenwartskunst, Basel); Unedited History. Iran 1960-2014 (Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris) | Text: Navid Kermanis Spiegel-Reportagen über seine Irakreise (überhaupt: alles von Kermani!), Interview mit einem zornigen Peter Handke («Manchmal hab ich Angst vor mir») | Schocks: der Berliner Spreewaldpark abgebrannt, Farocki und Glawogger machen keine Filme mehr (Vorfreude: Glawogger, 69 Hotelzimmer, erscheint 2015, Die Andere Bibliothek)