Filmphilosophie der verlorenen Zeit
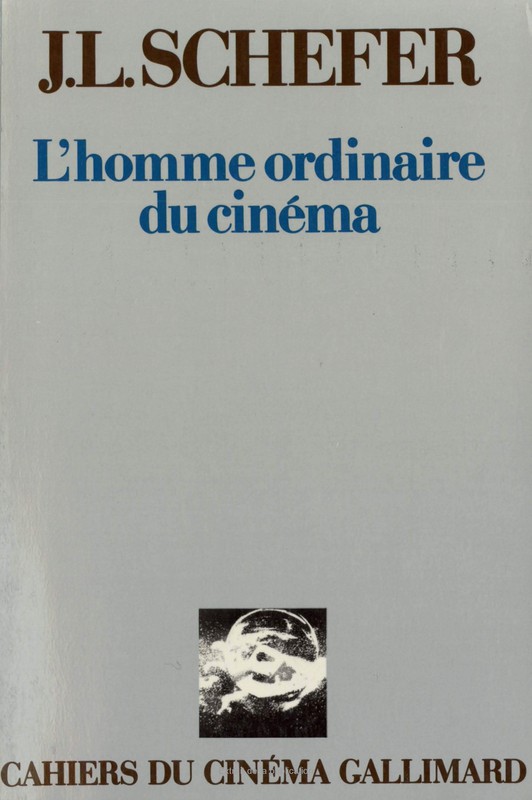
Das erste Mal begegnete mir Jean-Louis Schefers L’homme ordinaire du cinéma (1980) in der Bücherkiste eines Pariser Antiquariats. Das war 1996, ein Jahr bevor sein Filmbuch bei Cahiers du cinéma neu aufgelegt wurde. In erster Linie fiel mir das Coverbild auf, das heißt: die Schneekugel aus Citizen Kane. Auch Walter Benjamin zählte Glaskugeln, in denen es schneit, zu seinen «Lieblingsutensilien» (Adorno). Wenn ich heute Schneekugeln sehe, muss ich nicht nur an Benjamin und Welles denken, sondern vor allem auch an Schefer und seine Auffassung vom Kino als Simulationsort eines Neubeginns der Welt aus dem Gestöber tanzender Atome. Ganz nach dem Vorbild von Musils Der Mann ohne Eigenschaften beginnt die Re-Kreation der Welt aus den Fragmenten des Films mit meteorologischen Turbulenzen: mit einer Kette fundamentaler Trübungen der Verweisung. Der gewöhnliche Mensch ohne Eigenschaften geht ins Kino, um seinen Möglichkeitssinn auszubilden; er erfährt sich als anfangend. «Atmet ein neuer Mensch in mir?»
«Am Anfang war Jean-Louis Schefer», hat die französische Filmtheoretikerin Nicole Brenez einmal geschrieben. Schefer habe über den «Status der Analogie im Kino» radikal anders nachgedacht. Für Deleuze war Der gewöhnliche Mensch des Kinos «gleichsam ein großartiges Gedicht», ein Poem über die Erfahrung der Zeit als manipulierbares Bild. Dass dieser unerhörte Anfang, den Schefer setzte, im deutschsprachigen Raum bislang kaum erhört wurde, mag zum einen daran liegen, dass sich seine Filmbetrachtungen aus höchst unzeitgemäßen Quellen – u.a. der mittelalterlichen Scholastik und Patristik – speisen; zum anderen aber auch daran, dass sich sein prose poem zwar mit dem gewöhnlichen Menschen beschäftigt, hierbei aber Leser wie Übersetzer vor ganz und gar ungewöhnliche Herausforderungen stellt. Schefers eigenwillige Stilistik ist mit allen Wassern nicht nur der Rhetorik, sondern auch der surrealistischen Aleatorik gewaschen.
In der «Zeitklammer» eines Films werden wir nach Schefer von Monstren, körperlosen Schatten und «Vor-Körpern» (avant-corps) vampirisiert, die nur über uns – wie auch wir nur über sie – in Form kommen können. Wie von stummen Fischen aus dem Aquarium oder von Buster Keaton aus der Taucherglocke sehen wir uns auf der Leinwand von Wünschen angestarrt, die im «Lichtbad» der Projektion auf unser Ähnlich-Werden warten, sich aber außerhalb dieser Zeitklammer in uns zurückziehen wie Tentakeln in das innere Aquarium eines unformulierbaren Wissens.
Durch einen zweiten Schwerpunkt angehoben, den er im Film findet, wird der gewöhnliche Mensch im Kino marionettenhaft und «antigrav» (Kleist) aus der Welt gehoben, ohne sich auf der Leinwand aufgehoben fühlen zu können. Er pendelt zwischen den Welten, die sich gegenseitig unterdrücken und den Zuschauer wechselweise be- wie entwohnen.
Zwar wird der Kino-Mensch von den Bildern berührt, er selbst kann das von den Bildern Vergegenwärtigte aber nicht mehr berühren und diesem – gemäß der christlichen Theologie – somit auch nicht mehr ähnlich werden. An die Stelle jeglicher Messianik tritt bei Schefer eine gnadenlose Mechanik des Zu-spät-Kommens – und des Suspense, im Sinne eines Ungleichgewichts und einer Aufgespanntheit.
«Pauvres lecteurs, arme Leser!», antwortet Schefer – geboren 1938, Nachkomme einer deutschen Familie (Scheffer von Carlwaldt) und Neffe von Paul Válery («das Bindeglied ins 19. Jahrhundert […]: protestantische Banken, der Quai d’Orsay, Orientgelehrte, Maler und ihre Mäzene») – in seinem aktuellen Buch Le temps dont je suis l’hypothèse (P. O. L.) jenen Freunden, die ihn immer wieder überreden wollten, doch endlich einen Roman zu schreiben. Stattdessen schrieb und schreibt er autobiographische Essays, das «Romaneske ohne den Roman» (Barthes). Wie sein Freund (und rapporteur) Roland Barthes vollzog auch Schefer mit seinem ersten Filmbuch, für das er von Cahiers du cinéma regelrecht rekrutiert wurde, die Öffnung hin zu einer poststrukturalistischen Phase. Trotzdem sucht er bis heute an einer morale structurale festzuhalten, gilt er doch in Frankreich als Begründer einer sémiologie picturale. Sein schillerndes, kunsthistorisch wie archäologisch, linguistisch wie theologisch fundiertes Denken scheint kaum Grenzen und schon gar keine zwischen Hoch-, Populär- und Subkultur zu kennen. Hier begegnen sich Batmans Joker und Francis Bacon, der christliche Körper des Augustinus und der Körper der amerikanischen Burleske, die Geschichte der profanisierten Hostie und Bram Stokers Dracula.
Das versteckte, aber ausgesprochen kohärente Theorienkorpus von Schefers Kosmogonie ist nicht zu unterschätzen. Ich habe versucht, dieses Korpus in meinem Nachwort herauszuarbeiten. Was Schefer für mich in erster Linie geschaffen hat, ist eine unfassbar komplexe Mnemo- wie Traumatologie des Films. Unfassbar vor allem deshalb, weil sie die paradoxen Zeiteffekte des Kinos – wie eine écriture automatique – an den Leser weiterzugeben sucht. Der gewöhnliche Mensch erhofft sich von den Erinnerungseffekten des Kinos, das unwägbare Gewicht eines verlorenen Körpers, das heißt: seine Kindheit wiederzufinden.
Immer wieder tauchen Erinnerungsfetzen in Schefers monströsen Sätzen auf, Fragmente aus einer unvordenklichen Kriegszeit, die im Keller verbracht wurde, erfüllt von Bombendrohungen und Angstschweißgerüchen. Was dem Kind im cache des Kellers vorenthalten wurde, holt es auf der Leinwand wieder ein: «Die Katastrophe hatte nicht durch die Trümmer und nicht einmal durch die Trauer vordringen können, bis zu dem Tag, da man sie ins Kino brachte. Sciuscià.» Mit dem Film beginnt bei Schefer das Bewusstsein der Schuld und der Vorgängigkeit eines (Ur-)Verbrechens. Auch das Flackern und Pendeln der Glühbirne im Keller kehrt wieder, nicht nur als Flickereffekt am Grund des Kinodispositivs, sondern auch am Schluss von Hitchcocks Psycho. Die Mumienbänder und Erinnerungsschichten, die sich im Entrollen des Films wie Deckerinnerungen um den Körper des Unerinnerbaren wickeln, haben bei Schefer immer zugleich lindernde wie (re-)traumatisierende Effekte. Was bleibt, am Grund der Subjektivität, ist eine von innen verschlossene Poe’sche Kammer, eine Krypta, die nur vom Film ein Stück weit geöffnet werden kann, da das Kamera-Auge eine Zeit gesehen hat, aus der wir kein Bild hinüber retten konnten. «Ist die Großaufnahme nichts anderes als die Kindheit […]»? (Schefer)
Dass es mir nun möglich ist, das Buch herauszugeben, ist den Übersetzern Michaela Ott und Raimund Linden zu verdanken, die viel Übersetzungskraft investiert haben, um uns Schefers «drehende Sprachräder» zugänglich zu machen, der Förderung durch das IKKM (Weimar) und den Herausgebern von «FilmDenken» (Lorenz Engell, Oliver Fahle, Vinzenz Hediger und Christiane Voss), die es sich mit ihrer neuen Buchreihe (bei Fink) zum Ziel gemacht haben, medienphilosophische mit filmästhetischen Ansätzen zu verbinden. Dafür, dass das Buch sogar mit einem neuen Vorwort erscheinen kann, möchte ich mich besonders herzlich bei Jean Louis Schefer bedanken.