Die beste Filmkritik ist keine Harlan Ellison (1934–2018)
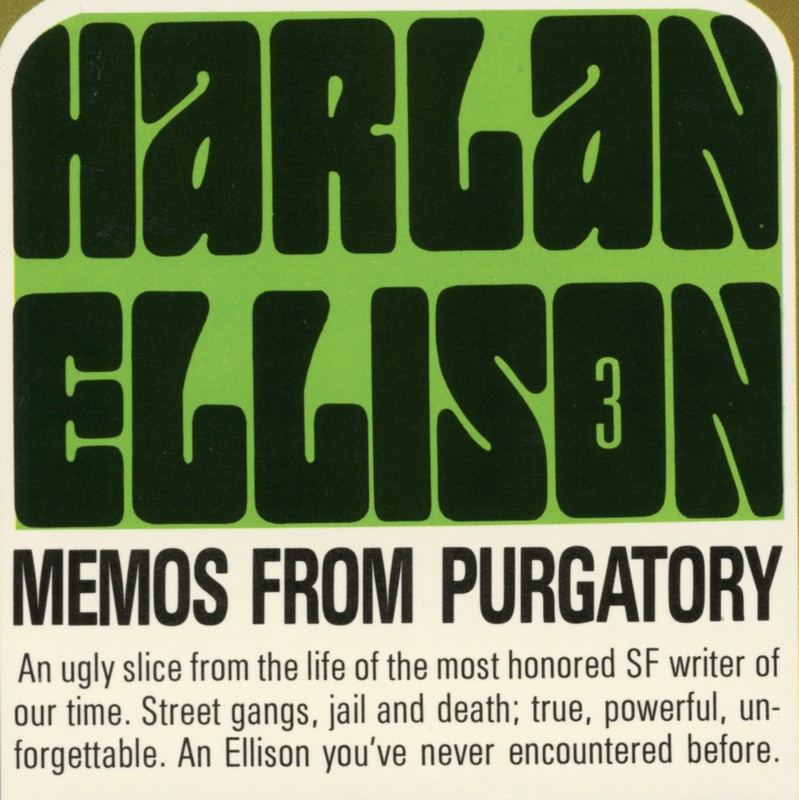
Eins: Ein Fernsehversagen
Der Mann schonte sich nicht, wenn er andere beschimpfte: Er nannte sich bitter, wütend und rachsüchtig. Er schrieb auch, ihm sei «im Herzen schlecht», weil etwas, an dem er mit Liebe gearbeitet hatte, «ermordet» worden sei und «vergewaltigt». Diese Wörter trauerten um ein von ihm verfasstes Drehbuch wie um ein Lebewesen, mehr: eine Person. Umgekehrt schrieb er seine eigene Person im selben Text zum Ding um, zur Sache, zum Beweisstück. Zwei Wochen früher, erzählte er, habe dieses Beweisstück sich noch bei einem Treffen der Writers Guild, einer Interessenvertretung von Autorinnen und Autoren für Film und Fernsehen, als kämpferischer Optimist in die Brust geworfen. Wer ans Handwerk und an die Wahrheit der Drehbucharbeit glaubte, sei im Fernsehen zum Scheitern verurteilt, hatten die anderen lamentiert, aber Herr Beweisstück habe ihnen widersprochen: Nein, man könne im Fernsehen Gutes zustande bringen, er habe das ja schließlich auch geschafft, indem er ( je nach den Umständen) mal bereitwillig Material ohne Entgelt umgeschrieben oder, ein andermal, Intransigenz nach dem Motto «was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben» gezeigt habe, auch Gespräche mit Produktionsangestellten geführt oder Drehorte besucht.
«Ihr werdet schon sehen», hatte er auftrumpfend angekündigt, «mein neues Skript für die Serie The yoUng LawyeRS wird euch zeigen, wie gut Fernsehen sein kann.»Zwei Wochen später schrieb er, er sei ein Narr gewesen, ein dummes, eitles, aufgeblasenes Arschloch, das von sich geglaubt hatte, es könne eine kopflose Schlange angreifen und töten. Sein Drehbuch war inzwischen umgesetzt und das Ergebnis war einen Tag vor Erscheinen der Selbst- und Fremdanklage, die ich hier referiere, gesendet worden. Er fand es schlecht nach jedem Maßstab, den man an einen Film überhaupt anlegen kann: «merely another bland example of video porridge. It says nothing. It avoids and skirts and shies away», ohne Aussage, ohne Figurenzeichnung.
Der Mann, von dem ich rede, Harlan Ellison, konnte damals davon ausgehen, dass seine Urteile über Film und Fernsehen ernstgenommen wurden. Als er seinen Ruf am 12. April 1971 in der hier referierten achtundneunzigsten Folge einer Kolumne aufs Spiel setzte, die diesen Ruf seit Jahren wesentlich mitgeprägt hatte, verdarb er es sich wissentlich und willentlich mit großen Teilen zweier Sorten von Kundschaft: einerseits Fernsehsenderverantwortlichen, die ihn hätten beschäftigen können, andererseits Leserinnen und Lesern, die seinen Ansichten objektive Geltung hätten zusprechen können.
Ellison wusste, was er tat. Er hatte sich den richtigen Publikationsort dafür ausgesucht: Die mehr oder weniger gegenkulturelle Wochenschrift Free Press (von ihrer Zielgruppe zärtlich Freep genannt) aus Los Angeles, 1964 gegründet. Sie hatte Ellison im Epochenwegmarkenjahr 1968 eingeladen, für sie besagte Fernsehkolumne zu schreiben, die ihr Verfasser «The Glass Teat» nannte, was «die gläserne Zitze» heißt und als Konsumkritik und Passivitätsvorwurf an die Glotzmassen gemeint war, weil die am Angebot der TV-Konzerne saugten, ohne eine vernünftige Nachfrage auch nur artikulieren zu können. Die Leute, die ihm am 12. April 1971 bei seiner Selbstentblößung als gescheiterter Fernsehverbesserer zusahen, verstanden sofort, dass hier kein Kritiker zusammenbrach, sondern ein anderer, älterer, schwierigerer Beruf über diesen gesetzt und damit eine Behauptung über das Verhältnis zwischen Kritik und diesem anderen Beruf aufgestellt wurde. Ellison be- glaubigte sich selbst in The Glass Teat einfach als das, als was ihn vorher und nachher Kolleginnen und Kollegen wie Dorothy Parker, Robert Bloch, Isaac Asimov, Joanna Russ und Neil Gaiman bewundert und gelobt haben: Schriftsteller.
Zwei: Ein Studioverbrechen
Jahre später, im August 1985, ging Ellison das Risiko, sich mit offen ausgestellter Distanzlosigkeit lächerlich zu machen, auch als Filmkritiker ein. Er hielt David Lynchs sowohl an den Kinokassen wie bei der Kritik bestenfalls schwach aufgenommenes Wüstenplanetenepos dUne für ein großes Kunstwerk. Anstatt seine argumentative Begabung für diese Meinung zu mobilisieren, setzte er sie als selbstverständlich und machte sich dann daran, zu erklären, warum sie offenbar ihm allein gehörte. Ellison erzählte diese Erklärung als Detektivgeschichte. Man lese sie am besten in seiner 1989 erstmals, 2008 dann in überarbeiteter Neuauflage erschienenen Filmessaysammlung Harlan Ellison’s Watching nach, ich kann hier nur ihre Grundzüge zusammenfassen: Der Kritiker war dem Film von Anfang an gewogen gewesen, lange, bevor er ihn hatte sehen können, wenn auch nicht ohne einen Rest Skepsis. Dieses Wohlwollen hatte er in seiner Doppeleigenschaft als Filmkritiker des seinerzeit weltweit literarisch anspruchsvollsten Phantastik-Periodikums The Magazine of Fantasy and Science Fiction und zugleich freier Mitarbeiter beim Simpelblatt USA Today den Verantwortlichen bei Verleih und Studio mitgeteilt, war aber beim Versuch, eine frühe Vorführung für Eingeweihte zu besuchen, nicht nur auf mangelndes Entgegenkommen, sondern zunehmend auf Hindernisse und sogar Feindseligkeiten gestoßen. Treu dem Noir-Genremuster war das der Moment, in dem der Held finstere Machenschaften ahnte und schließlich, dank Intelligenz und Hartnäckigkeit, auch enttarnen konnte: Recherchen, schrieb er, hätten ergeben, dass der böse Grund für seine Schwierigkeiten bei der dUne-Unterstützung ein Managementpersonalwechsel bei Universal Pictures gewesen sei. Neue Chefs hätten den Film scheitern sehen wollen, um diejenigen, die vor ihnen das Sagen gehabt hatten, nachträglich zu blamieren. Wer die Macht hat, einen Film zu bezahlen und herauszubringen, hat auch die Macht, ihn abzuwürgen. Ellisons wichtigste Quelle für das, was er ermittelt haben wollte, hat er nie preisgegeben, aber Widerrufe und Gegendarstellungen gab’s keine.
Ich halte Lynchs dUne für ganz in Ordnung, aber viel lieber, als mir dieses Ding noch einmal anzuschauen, würde ich eine Verfilmung von Ellisons Universal-Pictures-Krimi sehen (am besten auch gleich von Lynch inszeniert).
Drei: Risse, Brüche, Widersprüche
Harlan Ellison war keine in sich ruhende oder harmonische Figur. Seine Risse, Brüche, Widersprüche waren seine Stärken. Er agitierte gegen den Vietnamkrieg und war trotzdem kein Pazifist. Er stand auf Feindeslisten des Präsidenten Richard Nixon und des Gouverneurs Ronald Reagan und lässt sich doch, blättert man in seinen über mehr als ein halbes Jahrhundert verstreuten politischen Meinungsäußerungen, keiner traditionellen linken Denkschule zuordnen. Im Januar 1982 ergriff er öffentlich Partei für einen vielgeschmähten Toten, den naiven Terroristen Norman Mayer, der gedroht hatte, sich in Washington in die Luft zu sprengen, wenn die USA nicht sofort in nukleare Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion einträten. Ordnungskräfte erschossen den alten Mann, dessen Bombe bloß eine Attrappe gewesen war, und Ellison schrieb einen erschütternden Nachruf («They killed him because he cared too much»), für die ihn der pen-Club mit einem Journalistenpreis ehrte.
Ellison hat seine vielen Urkunden, Statuetten, Medaillen und Plaketten, seine Preise für Krimis, Science Fiction und Krimskrams in Streitigkeiten und Konkurrenzsituationen oft als Trümpfe ausgespielt. Er kannte sich selbst gut genug, den Grund dafür nicht zu verschweigen: Seine Kleinstadtkindheit in Ohio während der 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts war von Demütigungen und Gewaltakten entstellt; als Kind einer jüdischen Familie litt er unter üblem Provinzantisemitismus, als kleinwüchsiger Junge unter Hänseleien wegen Unsportlichkeit. Zurück blieb davon lebenslanger Ehrgeiz, aller Welt zu beweisen, dass er jemand war und etwas konnte. Eine Parole, die er schriftlich wie mündlich oft gebrauchte, setzt seine Erfolgs- beweise direkt zu der in ihnen vergegenständlichten Überwindung seiner frühen Peiniger in Beziehung: «Living well is the best revenge».
Ellison trat für schärfere Waffengesetze ein, gab aber in einer Talkshow auch zu, dass er eine Handfeuerwaffe besaß. Risse, Brüche, Widersprüche: Als Schriftsteller, also Autor klassischer Science Fiction, sonstiger Phantastik, Kriminalliteratur und brillanter Essays hat er seine Rache gehabt; seine Statur in allen Leselandschaften, die er je betreten hat, ist nicht zu übersehen – I Have No Mouth, And I Must Scream (1967), Jeffty is Five (1977), Paladin of The Lost Hour (1985), Mefisto in Onyx (1993) und viele andere sind Klassiker, darüber hinaus hat Ellison als Herausgeber der beiden Anthologien Dangerous Visions (1967) und Again, Dangerous Visions (1972) das Schreibspektrum und die Leseprotokolle der Gegenwartsphantastik (die er «speculative fiction» nannte) revolutionär erweitert und verbessert, nämlich vor der die Genres Fantasy, Horror und Science Fiction seinerzeit wie Schimmelpilz überwuchernden tödlichen Banalität des Eskapismus- und Klischeeschwachsinns gerettet (auf Zeit: the struggle never ends). So sehr er aber als Verfasser von Texten, die sich Menschen in ihren Köpfen in Bilder übersetzen, alle seiner Autorengeneration überhaupt erreichbaren Ziele erreicht hat, so unklar bleibt, ob die Arbeit, mit der er das alles finanzieren konnte, nämlich das Schreiben für Film und Fernsehen, je das volle Potential seiner Affinität zu diesen Medien verwirklichen konnte.
Drei: Leinwand, Schirm, Fetzen und Scherben
Memos from Purgatory erschien 1961. Das Buch ist eine Undercover-Erlebnisreportage, in der Ellison seine Zeit als Mitglied einer Straßenbande protokolliert hat. Ein Teil davon wurde 1964 als Doku-Fiction-Folge der Teledramenreihe The aLFRed hiTchcocK hoUR inszeniert, mit James Caan als Jay Shaw, Ellisons Alter Ego. Ein großer Erfolg: Wer wollte nicht von James Caan gespielt werden? Noch mehr Ehre machte dem Verfasser von Memos from Purgatory seine STaR TReK-Episode «The City on The Edge of Forever» (1967), bei Fans wie bei der Kritik bis heute als Konsensgipfel (und oft als beste Folge der Serie überhaupt) anerkannt, auch wenn Ellison sich wegen einiger Änderungen, die an seinem Drehbuch vorgenommen wurden und nach der im Buch Harlan Ellison’s The City on The Edge of Forever (1991) zugänglichen Beweislage völlig überflüssig waren, mit dem STaR TReK-Erfinder und Produzenten Gene Roddenberry überwarf (eine von vielen Feindschaf- ten, die Ellison teils verursachte, teils erlitt und immer eifrig pflegte).
Weniger gelungen (und drastisch weniger erfolgreich) war sein einziger ernsthafter Versuch, als Hollywood-Drehbuchautor zu reüssieren: The oScaR (1966), eine quälend mittelmäßige Richard Sale-Romanadaption, die Ellison in mühsamer Kollaboration mit zwei anderen Skriptmietlingen geschrieben hat. Diese dröge Moralrevue konnten auch das Schauspieldebüt des Sängers Tony Bennett, das Timing von Milton Berle, der Charme von Ernest Borgnine, die Liebesmüh von Elke Sommer und die Regie von Russell Rouse nicht retten. Sehr viel besser geriet die von L. Q. Jones inszenierte (und von ihm zusammen mit Alvy Moore als Drehbuch adaptierte) Verfilmung einer der bekanntesten Erzählungen Ellisons, a Boy and hiS dog (1978), und noch besser wäre Ellisons leider nie gedrehte, nur als Drehbuch 1978 veröffentlichte Isaac Asimov-Bearbeitung I, Robot geworden (die nichts mit dem Scheißhaufen gemeinsam hat, der unterm selben Titel 2004 in der Regie von Alex Proyas auf den Markt geworfen wurde). Ellisons beste Filmideen sind unverwirklicht geblieben, von der zeitweilig bei mgm in einer bizarren Entwicklungsschlaufe rotierenden Zwei-schwule-Privatdetektive-Story, die Ellison den beiden Stars Paul Newman (!) und Sidney Poitier (!!!!) zugedacht hatte, bis zum hypothetischen dritten Derek Flint-Film (nach den zwei ersten in dieser abgebrochenen Trilogie mit James Coburn als psychedelischem B-James-Bond, oUR man FLinT von 1966 über verrückte Wissenschaftler, die eine Wetterterrormaschine gebaut haben, und i LiKe FLinT von 1967 über eine feministische Verschwörung, die das Patriarchat wegputschen will).
Drei: Nachweltlektüren
Kaum war Ellison am 28. Juni 2018 gestorben, schnappten im Netz und in Printerzeugnissen allerlei Leute nach ihm, die ihn hassen werden, so lange sie leben (also länger, als er gelebt hat). Einer beschwerte sich, die Darstellung von Absonderlichkeiten im Verhalten von Science-Fiction-Fans, die Ellison in seiner Zornrede Xenogenesis (1990) gegeben hat, sei unwahr. Der Text war als Versuch gedacht gewesen, Personen zu beschämen, die sich mit Utopien befassen und daran aufrichten, aber keinen Respekt vor wirklichen Menschen haben. Einer der zahlreichen Geschädigten, die darin zu Wort kamen, war Ellison selbst, der auf einem Science-Fiction-Fankongress hatte erleben müssen, wie ihn ein T-Shirt- Aufdruck zum fünfzigsten Geburtstag mit dem Kleiner-Mann-Flachwitz «50 Short Years of Harlan Ellison» belästigte. Der vergrätzte Nachrufer nun nahm Ellison tatsächlich noch zwanzig Jahre später übel, dass er über diesen Spaß nicht hatte lachen können; so sehr hatte die Xenogenesis-Ohrfeige gesessen.
Andere Unzufriedene schimpften an Ellisons Grab darüber, dass er als Greis einer alten Dame und beliebten Schriftstellerin namens Connie Willis 2006 bei einer Preisverleihung als Revanche für berufliche Kränkungen und Verhöhnungen auf offener Bühne mit idiotischen sexualisierten Gesten auf den Leib gerückt war. Menschen, die ihn mochten, seine Werke für bedeutend halten oder beides, reagierten auf solche Wiederholungen alter und jüngerer Vorwürfe mit braven Aufzählungen seiner künstlerischen und außerkünstlerischen Verdienste: Hatte er nicht im Gefolge von Martin Luther King gegen Rassismus demonstriert? Hatte er nicht unter Inkaufnahme auch finanzieller Einbußen den Frauengleichstellungszusatz zur US-Verfassung unterstützt? Hatte er nicht sogar zwei der bekanntesten Women of Color in der SF-Welt gefördert, Octavia Butler und Tananarive Due?
Ellison lebt nicht mehr. Wer ihm sein Verhalten vorhalten will, könnte stattdessen daran denken, dass er es nicht mehr fortsetzen kann und also nicht mehr daran gehindert werden muss, sich schlecht zu benehmen. Nach einer psychoanalytischen Binsenweisheit unterhält die männliche Durchschnittsseele zu Vaterfiguren zwangsläufig Ambivalenzen. Bei Ellison erübrigt sich das für viele seiner Schüler, auch für mich, und für seine Schülerinnen sowieso: Er war alleine ambivalent genug, man konnte ihn also einfach lieben. Ich zum Beispiel werde damit fortfahren, so lange ich halbwegs bei mir bin. Was ich mir wünsche, ist, dass er weiterhin gelesen werde (leider gibt es keine deutschen Übersetzungen, die ihm gerecht werden; das kann noch dauern, ich brächte sie auch nicht zustande, die Aufgabe ist schwierig. Ich darf das so grob sagen, denn der Mann, um den es geht, hatte für Diplomatie nichts übrig).
Harlan Ellison war ein sehr seltener Fall: ein Erzähler, den man nur richtig liest, wenn man ihn als Kritiker kennt, und ein Kritiker, den nur versteht, wer ihn als Erzähler begreift. Dass es davon nicht viele gibt, ist sehr bedauerlich, weil man, sofern man Ästhetik als Wahrheitswerkzeug begreift, unter den gegenwärtigen Informations-, Kommunikations-, Wissens- und Kunstbedingungen zwischen Schrift, Klang und Bild nicht weniger wollen sollte, als dieser Mann vollbracht hat, falls man das Publikum nicht anöden, verraten oder verkaufen will.